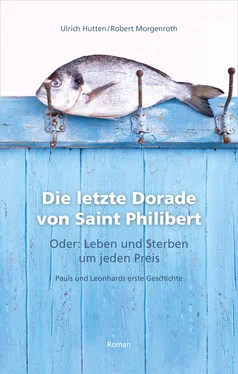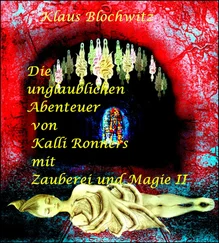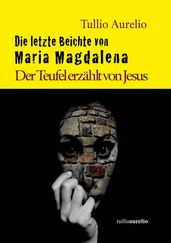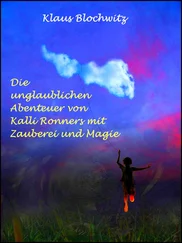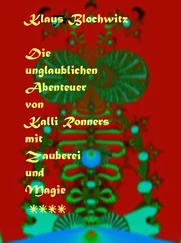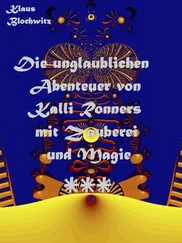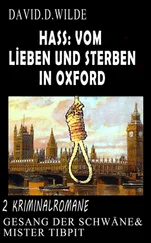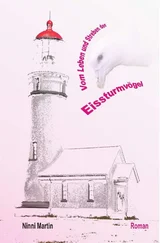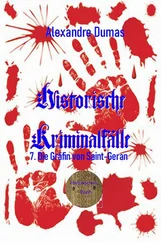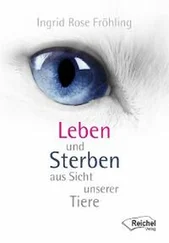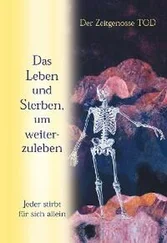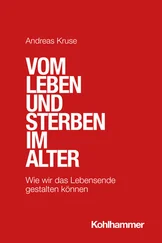*
Derweil hatte im Osten, an der bretonischen Küste jenseits des Atlantiks, die Vormittagssonne dem neuen Tag schon die Frische gestohlen. Charles Dupont musste sich zusammennehmen, um nicht laut zu schnarren, als er die schwarz gekleidete Gesellschaft in das Kirchlein Saint Cornély in Carnac einlaufen sah. Hinter dem mit orangeroter Amaryllis geschmückten Sarg schritt in festlichem Ornat der asketisch hagere Père Caneloux mit seinem Schlangengesicht. Ihm folgten, etwas linkisch die Weihrauchgefäße schwenkend, vier Messdiener. Der Père verneigte und bekreuzigte sich vor dem Altar. Dann drehte er sich um und besprengte mit einem silbernen Klöppel den Sarg mit Weihwasser, ganz im Gestus tief empfundenen Bedürfnisses, den dahingeschiedenen Charles Dupont persönlich auf dem Weg ins himmlische Paradies zu begleiten.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Cis, E, Gis. Der Atlantikwind fing das melancholische Moll der Totenglöcklein ein und trug ihr Zittern hinaus in die Weiten des Morbihan, wo es ein paar Menschen anwehte für einen Moment. Tod, Leid und Schmerz hatten eigentlich nichts verloren hier in Carnac, hier in den kleinen lebensfrohen Badeorten an der Bucht von Quiberon, der bretonischen Riviera, wo die Menschen es sich gut gehen lassen und Pinien, Villen, Hotels und nordisch atlantischer Strand fast südländisches Flair und mediterrane Lebenslust verströmen. Aber selbst hier wurde gestorben.
In gebührendem Abstand zu den Messdienern bewegte sich, den blassen Teint von einem schwarzen Netzschleier umhüllt, Gisèlle Dupont, die rechtmäßige Ehefrau des Verblichenen. Auch diese Rolle, die Rolle der fassungslosen Witwe, spielte sie bravourös. Aller Augen hefteten sich auf sie und das enge, schwarze Kostüm, das ihre Figur begrenzte. Sicher, sie war ein wenig in die Jahre gekommen, aber immer noch eine ausnehmend schöne Frau. Das würdevolle Leid, das sie ihrem bleichen Antlitz aufgetragen hatte, stand ihr gut. An Gisèlles Seite ein sonnengebräunter Mittvierziger. Zur Verblüffung der einheimischen Trauergemeinde.
Auch Charles Dupont irritierte diese Begleitung. Nun erinnerte er sich vage. „Das ist Nikolas Plage“, hatte sie ihn vor einiger Zeit vorgestellt, beiläufig. Er hatte sich den Namen nicht gemerkt, hatte Wichtigeres zu tun, als ihre zahlreichen Liebhaber im Kopf zu behalten. Aber vielleicht hatte er, dachte er sich, doch so einiges übersehen im Leben seiner Frau, zumal in der Hektik der letzten Wochen?
Dem Paar folgten Carnacs kahlköpfiger Bürgermeister Eugène-Marie le Pont, dann der pockennarbige Vorsitzende des Yachtclubs von Saint Philibert, erst danach die übrigen Clubmitglieder. Auf den hinteren Bänken saßen neugierige Alte, notorische Kirchgänger, die sich kein einziges Begräbnis entgehen ließen, waren sie doch ein fast so ergiebiger Zeitvertreib wie der Besuch öffentlicher Gerichtsverhandlungen. Zeit hätte in ihrer letzten Lebensphase eigentlich ein zu kostbares Gut sein müssen, um sie zu vertreiben. Aber hier war der Tod immerhin live zu erleben und bereitete unterhaltsam auf die eigene Endlichkeit vor.
Auch harmlose Honoratioren und Kleinbürger aus Carnac hatten Platz genommen, die bei einer derart bedeutenden Trauerfeier einfach nicht im Abseits stehen konnten. Man sollte sie hier sehen, obwohl sie in ihrer überwältigenden Mehrzahl Charles Dupont nicht ausstehen konnten, wenn nicht sogar hassten.
Sie alle, die ihn tot wähnten, vergossen nicht eine einzige Träne, auch wenn sie pflichtschuldig ihre betretenen Mienen aufgesetzt hatten. Charles wunderte das nicht. Nur die Eingeweihten schluchzten für besondere Momente oder taten so als ob. Charles hatte sie alle im Blick. Es war genau so, wie er es sich vorgestellt hatte.
Wie gut, dass ich tot bin, sagte sich Charles und beobachtete gebannt das Spektakel. Er betrachtete es als eine Art Festakt, den man für ihn veranstaltete. Gut getarnt, geschminkt und verjüngt mit einem rötlich-grau gefärbten Dreitagebart, einer sanft gekrümmten Gumminase, Sonnenbrille und einem schwarz-grau melierten Toupet verharrte er auf der Empore des neugotischen Kirchleins, nur wenige Meter von der Orgel entfernt, ein unauffälliger Trauergast in gut geschnittenem schwarzem Anzug, um den sich niemand kümmerte. Bei einem Schuhmacher in Nantes hatte er Sohlen und Absätze aufrüsten lassen. Nun würde ihn niemand am leicht hinkenden Gang erkennen. Oder an seinem vermaledeiten Schnarren. So wirkte er fast unscheinbar, so als hätte er seine frühere Präsenz einfach abgestreift. Aus diesem Grund wollte Charles Dupont abwarten, bis sich die Gäste am Ende der Trauerfeier verlaufen hatten. Hätte der Père mit dem Schlangengesicht geahnt, das Dupont so tolldreist sein würde, in Saint Cornély seiner eigenen Beerdigung beizuwohnen, er wäre sicher ins Stottern gekommen. Sogar beim Vaterunser. Das konnte er sonst im Schlaf herunterbeten.
Die Größe der Trauergemeinde war beträchtlich. Nur an Heiligabend war das Kirchlein im Herzen von Carnac besser gefüllt. Einer jedoch, den Charles erwartet hatte, fehlte. Es war Albert, der Ober des „La Mer“ im benachbarten Yachthafenstädtchen Saint Philibert. An dessen Hafenpromenade war Charles Dupont ein gern gesehener, regelmäßiger Stammgast und eines der prominenten Mitglieder des Yachtclubs. Albert war eingeweiht, aber nicht der Einzige, der wusste, dass in diesem Sarg zwar ein Leichnam, aber bestimmt nicht der Duponts seine letzte Ruhe finden sollte.
Père Caneloux verneigte sich jetzt auch mit Worten vor dem Verblichenen und rühmte dessen großzügiges finanzielles Engagement für das Musée de Préhistoire im ehemaligen Priesterseminar und für das Freilichtmuseum in Carnac. Und überhaupt für den Erhalt des megalithischen Erbes des Morbihan. Ein Reichtum an Dolmen und Menhiren wie kaum anderswo. Steinkreise, kilometerlange Reihen, verwittert, flechtenübersät, deren prähistorische Vergangenheit der Fachwelt bis heute Rätsel aufgeben.
Für diese geheimnisumwitterten Riesen aus Granit, drei-, vier-, fünftausend Jahre alt, hatte sich Charles schon in seiner Jugend brennend interessiert, als er ihnen auf Malta zum ersten Mal begegnete. Er hatte sich auf alles gestürzt, was damit zu tun hatte, hatte es als hungriger Junge in sich hineingefressen wie Reisbrei mit Rosinen, hatte bewundert, wie die einfachen Megalithsteine und die mächtigen pi-förmigen Dolmen mit ihrer waagerechten Deckplatte eine Art Freiluftkammer bilden, hatte herausgefunden, wie sich die steinernen Giganten aus dem Nahen Osten, aus der Türkei, wo man jüngst in Göbekli Tepe die mit 12.000 Jahren älteste Kultstätte der Welt ausgrub, über das Mittelmeer bis nach Stonehenge und weiter nach Irland verbreiteten. Die unbekannten Völker aus der Jungsteinzeit, ihre Kulte und Kulturen, hatten seine jungenhafte Phantasie entzündet wie alle Sagen und Mythen, die er als Kind lesend verschlang. Sie waren bis zur Pubertät seine Gegenwelt zu den intellektuellen Vernunftanforderungen aus Elternhaus und Schule, sein Rückzugsraum, seine Höhle, in der er sich lebendig und frei fühlte, ein Held, der alles tun und lassen konnte, was er wollte.
Noch als Erwachsener erfreute sich Charles geradezu kindlich an den schwergewichtigen Hinkelsteinen, die Obelix mit spielerischer Leichtigkeit zu Dolmen verarbeitete oder lieber noch in ein Knäuel römischer Legionäre kickte. Dabei war es ein solcher Hinkelstein, der beim Herumklettern sein Bein zum Hinkebein verunstaltet hatte. Er hatte ihn, den elfjährigen Jungen, fast zermalmt. Dass er überlebte, war Glück. Er hatte schon oft Glück gehabt beim Überleben. Bislang.
Obwohl er über diese gewaltigen Steinbrocken so gut wie alles wusste, genoss er es, wenn Père Caneloux in gut gelaunter Rotweinrunde die Gelegenheit nutzte, um allerlei lokale Geschichten über deren Ursprung zu erzählen. Besonders gern verbreitete der Priester die Legende des örtlichen Kirchenpatrons, des Heiligen Cornély, immerhin kein Geringerer als Cornelius, 21. Nachfolger auf dem Stuhl Petri in Rom. Der, so verkündete Caneloux es bei jeder Gelegenheit und voller lokalpatriotischem Stolz, habe sich den Caesaren zum Trotz mutig geweigert, dem heidnischen Kriegsgott Mars zu opfern. Vor seinen römischen Verfolgern habe er bis in die Bretagne fliehen müssen. Hier aber habe er die Schergen des Kaisers in das Heer mannshoher Steine verwandelt, die bis zum heutigen Tage das Wunder des Heiligen bezeugen.
Читать дальше