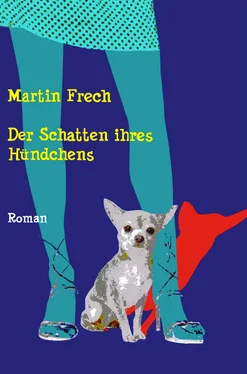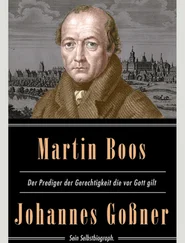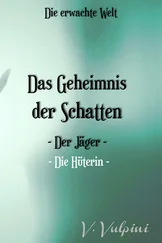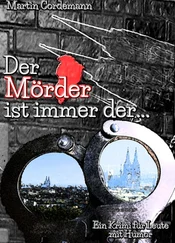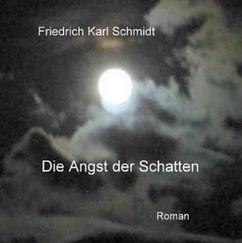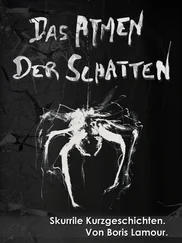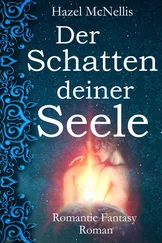Ein Trost immerhin war, dass sie nicht sehr viel mehr als einige Bücher und ihre persönlichen Sachen mitgenommen hatte, was sie damit begründete, dass ja alles von meinem Geld angeschafft worden sei. Damit verletzte sie mich zwar einerseits, weil ich uns immer als Einheit empfunden hatte, was, meiner Meinung nach, eigentlich auch zur Folge hätte haben müssen, dass, was wir uns für den gemeinsamen Haushalt zulegten, uns gehörte und nicht dem einen oder dem anderen. Ich war davon ausgegangen, dass das auch ihre Sichtweise sei. Nun kam es mir so vor, als sei ihr Hinweis bezüglich der Eigentumsverhältnisse eine nachträgliche Aufkündigung dieser Einheit oder gar, als wollte sie mir zu verstehen geben, dass es so eine Einheit nie gegeben habe. Andererseits aber machte mir diese Zurückhaltung beim Mitnehmen doch wieder ein bisschen Mut, weil man es ja auch so interpretieren konnte, dass sie die bestehende Form der Wohnung, unserer Wohnung, die wir gemeinsam gesucht und gemeinsam eingerichtet hatten, nicht zu zerstören wünschte, weil sie sie als für unser Zusammenleben zentralen Ort betrachtete und diesen erhalten wollte, woraus man wiederum folgern konnte, dass für sie unsere Beziehung doch noch nicht endgültig gescheitert war oder zumindest von ihr nicht als nicht wiederherstellbar angesehen wurde.
Meine Tätigkeiten außerhalb der Agentur beschränkten sich in diesen Wochen weitestgehend auf das, was jede mittelmäßige Film- oder Romanfigur in einer entsprechenden Situation getan hätte und was ich aufgrund meiner Sympathie für nicht wenige dieser traurigen Gestalten fast schon als so etwas wie meine Pflicht betrachtete: Rauchen (Gauloises), Trinken (Scotch) und Grübeln (endlos und quälend). Immer wieder versuchte ich zu rekonstruieren, was gewesen war und dieses Gewesene zu analysieren, aber meistens kam ich nicht allzu weit damit, weil mich der ständig steigende Alkoholpegel bald daran hinderte, noch einen einigermaßen klaren Gedanken zu fassen. Die Düsterkeit und die Ausweglosigkeit und der Whisky ermüdeten mich schließlich so sehr, dass mir die Augen zufielen. Am nächsten Abend fing alles wieder von vorne an.
Es dauerte nicht lange, bis gewisse Veränderungen vor allem in meinem Gesicht unübersehbar waren: Ich bekam so etwas wie Bäckchen, die aber leider nichts Frisches, Gesundes hatten; die Haut wurde blasser, unter den Augen entwickelte sich eine zuerst zarte, aber an Intensität schnell zunehmende blau-violette Tönung, und über das Weiß der Augäpfel legte sich ein Netz rötlich schimmernder Äderchen, dessen Maschen immer enger wurden. Auch mein Haar schien allmählich stumpfer zu werden, was mich veranlasste, ihm nach dem morgendlichen Duschen etwas Gel zuzusetzen.
Auf der Arbeit stellte dies alles erst einmal kein Problem dar. Dort gab es immer wieder solche Fälle, und solange man funktionierte, durfte man auch etwas angenagt aussehen – die Kleidung selbstverständlich ausgenommen. Christine aber, die sich etwa vier Wochen nach ihrem Auszug endlich wieder meldete und mit der ich mich einige Tage später in einer Pizzeria traf – zu mir nach Hause kommen wollte sie nicht, weil, wie sie sagte, unsere Situation sich geändert habe und einen anderen als den vertrauten Rahmen nötig mache, der einen, womit sie natürlich sagen wollte: mich , am Ende nur auf die Idee bringe, es sei möglich, da weiterzumachen, wo wir aufgehört hätten - wir! -, und ich wiederum wollte mich nicht mit ihr in der Wohnung, die sie inzwischen gefunden hatte, treffen, weil das nichts anderes gewesen wäre als ein deutliches Zeichen dafür, dass ich mich mit den von ihr geschaffenen Tatsachen doch abzufinden bereit war und ein Schritt in Richtung Anerkennung einer Situation als normal, die ja weder normal war noch es werden sollte – Christine gelang es nicht, sich der Wirkung meines Säuferantlitzes zu entziehen. Zwar glaubte sie mit der Frage, ob ich jetzt den Kaffee durch Schnaps ersetzt hätte, zeigen zu können, wie unbeeindruckt sie war, aber ich merkte genau, wie sie erschrak, als sie mich erblickte, und es tat mir gut!
Ansonsten sah es immerhin nicht so aus, als sei schon ein anderer an meinen Platz getreten oder zumindest auf dem Weg dorthin, wenn sie es auch ablehnte, sich deutlich zu diesbezüglichen Fragen zu äußern. Mein Eindruck war, dass sie vor allem deshalb eine klare Aussage zu diesem Thema verweigerte, weil sie mir nicht das Gefühl geben wollte, ich hätte ein Recht auf solche Fragen – was ja wiederum Rückschlüsse auf eine gewisse Qualität unserer Beziehung zugelassen hätte.
An einem lauen Sommerabend wurde ich dann doch schwach. Christine hatte mir erlaubt, sie ins Petit Escargot zum Essen einzuladen, wir hatten eine Flasche Châteauneuf du Pape dazu getrunken, waren noch ein bisschen spazieren gegangen, und als sie schon im Begriff war, vor ihrem Haus aus meinem Auto zu steigen, fragte sie mich, ob ich nicht Lust hätte, noch auf einen Schluck mit nach oben zu kommen. Ich stufte kurzerhand mein Prinzip, ihre Wohnung nicht zu betreten, als nicht mehr dem Stand der Entwicklung gemäß ein und ging mit, obwohl mir klar war, dass ein oder zwei Cognac und später vier Abschiedsküsschen – zwei auf die linke und zwei auf die rechte Backe – alles waren, was ich zu erwarten hatte. Natürlich würde dieser Schritt immer noch die sozusagen „offizielle“ Anerkennung dieser Wohnung als der ihren bedeuten und damit auch in gewisser Weise die Anerkennung unseres Getrenntseins. Doch was würde ein Beharren auf meiner Verweigerungshaltung bewirken? Womöglich genau das Gegenteil dessen, was mein Ziel war, nämlich eine weitere Entfernung voneinander dadurch, dass gerade die privatesten Orte als Treffpunkte ausgeschlossen blieben. Daneben konnte man Christines Angebot durchaus auch als Vertrauensbeweis betrachten, als Zeichen dafür, dass sie nicht befürchtete, von mir, sobald der Schutz der Öffentlichkeit nicht mehr bestand, begrapscht oder befummelt zu werden. Dass ich es gerne getan hätte, wusste sie, ebenso wie ich wusste, dass dies das Ende gewesen wäre. Und schließlich würde mein Betreten ihrer Wohnung es ihr erleichtern, auch wieder zu mir nach Hause zu kommen, in unsere Wohnung, denn unsere Wohnung war es nach wie vor, nicht nur aus formalrechtlichen Gründen oder weil ich das so empfand, sondern nicht zuletzt auch, weil ihr Erscheinungsbild immer noch weitestgehend das gleiche war wie zu den Zeiten, als wir sie tatsächlich gemeinsam bewohnt hatten.
Christine freute sich sichtlich, als sie das Licht einschaltete und die Worte „das ist mein Arbeitszimmer“ aussprach. Mir versetzte, was ich sah, einen Stich, und ich bereute fast, mitgekommen zu sein. Es war gut! Das Zimmer war schön renoviert, die Holzdielen abgezogen, die Möblierung sparsam, aber nicht so, dass man den Eindruck hatte, es fehle etwas. Mir wurde mit einem Schlag klar, wie unrecht ich damit hatte, die Tatsache, dass fast alle ihre Bücher noch bei mir standen, nur als Zögern ihrerseits zu interpretieren, vollständig und damit in gewisser Weise endgültig auszuziehen, was ja auch der Trennung noch einmal ein ganz anderes Gewicht verleihen würde. Dieses Zurücklassen der Bücher, das Sich-Beschränken auf das, was sie für ihre Arbeit brauchte, nämlich vor allem Wörterbücher und Lexika, konnte, ebenso wie der Verzicht auf viele andere Dinge, die noch bei mir herumstanden, auch als Abwerfen von Last verstanden werden, von Unnützem, Platzraubendem, einem den Weg und den Blick Verstellendem, und sei es auch nur den Blick auf eine weiße Wand, der das Auge und damit das Gehirn ja in viel geringerem Maß festlegt als der Blick auf Bücher und Möbel. Eine weiße Wand, das hat etwas Leichtes, der Phantasie Raum Lassendes und damit Möglichkeiten Eröffnendes – und haben Möglichkeiten nicht etwas mit Zukunft zu tun? Dieses Zimmer atmete beides, Möglichkeiten und Zukunft, es hatte etwas von einer Studentenbude auf hohem Niveau, dabei das Offene, Schlichte mit Geschmack und einem Sinn für Ausgewogenheit verbindend. Es erlaubte durchaus mehr, als es hatte, aber es brauchte nicht mehr. So gesehen spiegelte es wahrscheinlich perfekt die momentane Gefühlssituation Christines wider. Es machte mich traurig.
Читать дальше