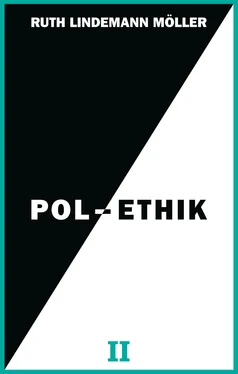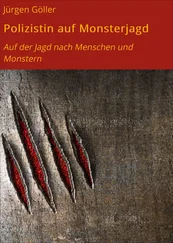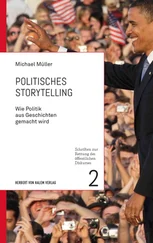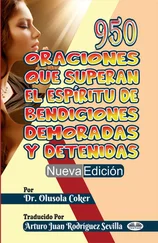Diese Tendenzen verstärkten sich. Plötzlich gab es keine lokale große Schlachterei mehr und Tiere mussten weit verfrachtet werden. Sogar bis nach Deutschland, weil da die Arbeitslöhne noch niedriger waren als bei uns. (Arme Tiere!) Freie Marktwirtschaft nennt man das. Nur die Freiheit der Tiere wurde eingeschränkt und sie mussten dafür leiden, wie auch lokale Arbeitsplätze verloren gingen und das Fleisch musste auch wieder zurückgefrachtet werden, wenigstens ein Teil davon.
Zurück zur Milch. Wenn es sich lohnen sollte Milch aus Deutschland nach Dänemark zu exportieren, müsste logischerweise die von den deutschen Bauern abgekaufte Milch viel billiger sein als in Dänemark, und auch müssten die Molkereipreise niedrig sein, ansonsten wäre ja kein Gewinn möglich. Daß da im Hintergrund eine starke deutsche Kette, einen von den fünf größten, eine starke Verhandlungsposition hat, um Preise zu drücken, muss wohl hier deutlich sein. Das Transportfirmen Fixkosten haben, daß Molkereien Kosten haben, ist unvermeidlich und einleuchtend – also wo können wir dann am leichtesten den Preis drücken? Bei dem Bauer. Wenn er versucht einen kostendeckenden und lebensnotwendigen fairen Preis zu verlangen, wird er seine Milch nicht los. Es stehen genügend andere Bauern bereit, seine Produktion zu ersetzen, um sich selbst zu retten.
Man müsste wieder einen nicht nur landesdeckenden Milchstreik in Gang setzen, um einen fairen Milchpreis durchzusetzen. Ganz Europa müsste solidarisch auftreten und mit Druck und Erfolg hätten wir dann vielleicht die Möglichkeit aus einer ver-rückten Lage wieder hinauszukommen, was Unterstützung und Subventionen betreffen.
Trotz großer Summen an EU Subventionen geht es für die Landwirtschaft den Bach hinunter. Wie war das vor Jahren ohne Subventionen? Da schafften es die meisten Bauern von ihrer Produktion zu leben. Sie hatten Mischbetriebe, das bedeutet Bodenbetrieb wie auch verschiedene Tierhaltung, Kühe, Schweine, Hühner etc. Sie waren nicht, wie heute sehr oft, spezialisiert auf Schweinefarm, nur Milchproduktion oder Hühnerfarm... Ihr Risiko war verstreut. Sehr vernünftig, und das kennzeichnete die Bauern früher. Was hat die EU mit unserer Landwirtschaft getan? Was haben die Subventionen (Zuschüsse) bewirkt? Sind Zuschüsse wirklich nötig?
Jetzt bin ich ein mittelgroßer Bauer und produziere ein Kilo Milch. Die „freie“ Marktwirtschaft (oder unfreie?), wir sind ja so liberalisiert, hat zur Folge gehabt, daß mein Kilo Milch mir nur 0,22 € bringt. Das deckt meine Kosten nicht ab und wovon soll ich dann leben? Ist es sinnvoll, daß der Staat, und die EU, subventioniert? Wäre es nicht klüger zu einer anderen freien Marktwirtschaft zurückzukommen doch mit Begrenzungen, die ich später ansprechen werde. Die echte Nachfrage bestimmt den Preis, wo nur so viel produziert wird wie hier nachgefragt wird und einen kleinen Zusatz für weiter verarbeitete Spezialprodukte für Export dazu. Aber nur was wirklich im Ausland verkauft werden kann ohne Subvention! So machen wir nicht die Situation für die armen Bauern in Entwicklungsländern noch schwieriger, und unseren Bauern würde auch nicht geholfen, wenn sie zu „dumping“ Preisen ihre Milch loswerden.
Wie viele Jahre reden wir schon von „Fair-Trade“ Produkten. Kaffee fällt mir sofort ein. Die armen Bauern anderswo, die kaum von deren Kaffeeproduktion überleben können. Da wissen wir heute ganz genau: Diese Bauern müssen einen fairen Preis für deren Produkt bekommen. Da dürfen wir nicht zulassen, daß der Produzent einer Kaffeemarke den guten Profit für sich behält. Nein, da wollen wir jetzt sichern, daß der Bauer fair bezahlt wird.
Wie steht es um die Milch? Wollen wir hier nicht auch sichern, daß unsere Bauern überleben können und einen fairen Preis bekommen? Oder sollen auch hier die Letzten in der Kette vor dem Verbraucher oder noch dazu auch der Verbraucher das Geld einstecken? Wäre es nicht für alle fairer und besser, wenn ein Kilo Milch kostet, was es kostet zu produzieren und so auch direkt von dem Verbraucher bezahlt werden würde? Die meisten vergessen oder sehen gar nicht, daß diese Subventionen Steuergelder (unser Geld) sind, die eingespart werden könnten. Früher hat die Landwirtschaft ja ohne funktioniert. Die, die jetzt am meisten davon profitieren sind die Großkonzerne. Für den Normalbauer reicht es sowieso nicht aus. Wir kommen nicht herum. Die Mengen müssen wieder reguliert werden, auch mit Zwang bis sich wieder eine vernünftige Preis/Nachfrage eingestellt hat.
Zum Schluss. Milch ist zu billig heute. Selber werde ich einmal in der Woche beliefert mit 2 Liter Frischmilch direkt von dem lokalen Milchbauer. Wie gut das schmeckt! Wie die Milch in meiner Kindheit. Dafür bezahle ich mit Freude 2.60 Euro (2017) und erhalte noch eine natürliche Milch, die nur ganz leicht pasteurisiert wurde und so viel bekömmlicher ist als Milch, die viele Prozesse durchmacht. Noch dazu wird es in retournierbaren Kanistern geliefert, nur der Plastikdeckel wird erneuert. Nächster Schritt wäre noch eine Mehr-Wegs-Deckel Schließung. Alle die, die Möglichkeit haben, fordere ich auf, sich auch beliefern zu lassen. Es würde dem einzelnen Bauern sofort direkt nutzen und es wäre gut, wenn viele ein Zeichen setzen, daß wir Verbraucher auch etwas zu sagen haben und es nicht zulassen werden, daß unsere lebenswichtige Landwirtschaft zunichte gemacht wird. Es ist spät, sehr spät, aber nicht für alle zu spät!
Zurück vor 1960: Die Bauern hatten fast nur Konkurrenz von anderen lokalen oder nationalen Bauern. Das war eine faire Konkurrenz. Warum? Weil mehr oder weniger dieselben Bedingungen allen gegeben waren. Die Arbeitslöhne waren fast die gleichen, das Saatgut wie Futter kostete dasselbe für alle. Daß einige Bauern tüchtiger als andere waren, gehört nicht unter unfaire Konkurrenz.
Mit der europäischen Union fing eine andere Zeit an: Freihandel innerhalb der EU, Entfernen von Zollbarrieren, womit sich die einzelnen Länder früher „beschützten“. Die Konkurrenz verlagerte sich jetzt auf den ganzen EU Raum. Den armen Bauern in den südlichen Regionen musste man hart unter die Arme greifen mit guter Unterstützung und Entwicklungsprogrammen. Sie waren jetzt schon unter hartem Konkurrenzdruck gekommen.
Besser wurde es nicht nachdem sich die immer weiter wachsende „Globale Ökonomie“ vordrang. Der Weltmarkt ist jetzt in den Achtzigern für die Überlebensfähigkeit der Bauern sehr wichtig geworden. Wo ich früher von „selben Bedingungen“ gesprochen habe, wird es deutlich, daß die Konkurrenzbedingungen nicht mehr fair waren/sind. Konkurrenten stammten unter anderem aus südamerikanischen und osteuropäischen Ländern mit Niedriglöhnen und, nicht wegzulassen, ganz anderen Umweltbestimmungen, wenn überhaupt welche. Dies gilt auch noch heute.
Wie soll ein europäischer Bauer da noch mithalten können? Durch höhere Produktionsleistung? Das war eine Zeit lang möglich, aber die Grenze ist jetzt erreicht. Ja, die Grenze ist sogar überschritten. Was zur Folge hat, daß ganz normal große Bauernhöfe aufgeben oder, wie am häufigsten, vom Geldgeber (Banken) aufgegeben werden. Warum? Weil sie es nicht mehr schaffen, die fallenden Preise und Einnahmen, durch höhere Produktion zu kompensieren.
In Europa werden Grenzen für zum Beispiel Kunstdüngermengen, Güllemengen, Spritzmengen, Antibiotika festgelegt. Zuletzt auch wie viel Platz ein Tier im Stall braucht (was gut ist). Diese Restriktionen sind aber nicht die gleichen in allen europäischen Ländern. Das hätte ich heute wohl nicht gedacht, wenn ich nicht über Jahre von meinem dänischen Freund und Bauer-Nachbar Lars Larsen, Verwalter von einem Gutshof, gut informiert worden wäre. Lars ist auch viele Jahre sehr aktiv in der Organisation von Bauern „Baeredygtigt Landbrug“ (tragbare/nachhaltige Landwirtschaft) gewesen.
Читать дальше