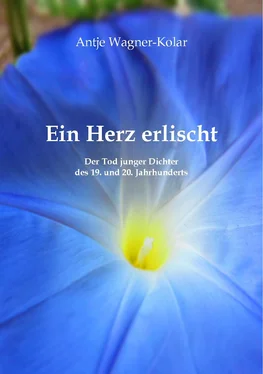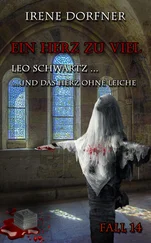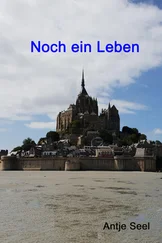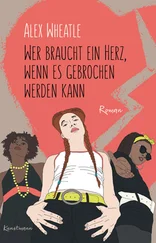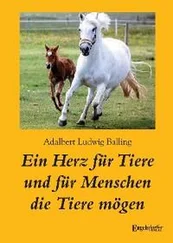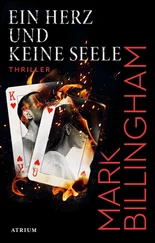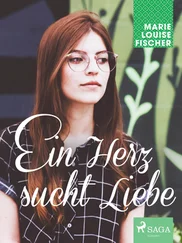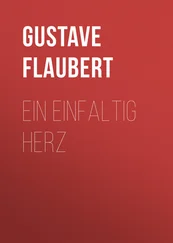| Ursache unbekannt: |
2.139 |
| Lebensüberdruss: |
951 |
| Geisteskrankheit: |
7.421 |
| mit Geistesstörung verbundene Leidenschaften: |
24 |
| körperliche Leiden: |
2.651 |
| Leidenschaften: |
745 |
| Laster: |
2.732 |
| Kummer über andere: |
331 |
| Zwist in der Familie: |
2.600 |
| Kummer über Vermögensverhältnisse: |
2.764 |
| Unzufriedenheit mit der Lage: |
253 |
| Reue und Scham: |
158 |
| Furcht vor Strafe: |
[568] 1.528 |
| Selbstmord nach Mord: |
165 |
(Quelle: Kirchner, Friedrich / Michaëlis, Carl: Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe. Leipzig 1907, S. 565-568)
Kulturpessimismus als Gegenform des Fortschrittglaubens beherrschte viele Teile der Künstlerszene. Ein Ende der Misere des sozialen und geistigen Elends beim Proletariat Ende des 19. Jahrhunderts war nur noch durch einen apokalyptischen Umbruch zu erwarten. Wer nicht warten wollte, beging Selbstmord. Aufgrund der hohen Suizidrate verbot das Reichsgesetz vom 13. Mai 1873 „über die Grenzen kirchlicher Straf- und Zuchtmittel“ die Diskriminierung von Selbstmördern. Letztlich hatte die Kirche nur noch die Möglichkeit, ihre Mitwirkung beim Begräbnis zu untersagen. Lediglich bei „notorischer Unzurechnungsfähigkeit“ konnte ein Begräbnis kirchlich stattfinden.
Trotz der neuen Gesetze zum Schutz der Unglücklichen gab es weiterhin die „Selbstmörderecken“ auf Friedhöfen, oder gar aufgrund der Ausweitung ganze Selbstmörderfriedhöfe (u.a. der dem weiter unten ein eigenes Kapitel gewidmetem Dichter Georg Heym lag auf einem solchen).

“Der Tod Chattertons” Henry Wallis (1856)
7 Naturalismus (ca. 1880-1900)
Was den Naturalismus im Besonderen auszeichnet, ist seine unverblümte Darstellung der Wirklichkeit, verbunden mit einer professionellen Naturbeobachtung. Es wurde versucht, dem „Ungeschliffenen“, dem „Hässlichen“ einen Platz in der Kunst zu verschaffen. Die Naturalisten standen den Realisten zwar noch sehr nahe, waren in ihrem Wirken als Literaten jedoch radikaler, indem sie die Grundidee des Realismus konsequent zu Ende dachten. Alltagsmenschen, die zuvor missachtet oder einfach nur in der Literatur ignoriert wurden – wie z.B. Geistesgestörte, Alkoholiker oder Arbeiter – wurden zu Protagonisten, zu Hauptdarstellern des Naturalismus.
In Frankreich war es Emile Zola (1840-1902), der diese Literaturepoche begründete, in Deutschland war wohl Arno Holz (1863-1929) einer der größten Verfechter des Naturalismus. Der Norweger Hendrik Ibsen (1828-1906) hatte in seinen Dramen (erfolgreich) versucht, den gegen sein Milieu protestierenden Menschen darzustellen („Nora“).
Wie im wahren Leben gab es plötzlich keine Monologe mehr (wobei… wer hat nicht schon mal ein Selbstgespräch geführt) und in Theaterstücken wurde mit Dialekten gearbeitet, um eine gewisse Wirklichkeitsnähe zu erzielen. Der neu kreierte Sekundenstil in naturalistischen Romanen als minutiöse Detaildarstellung des sozialen Verfalls galt schon bald als gescheitert und wurde in späteren Werken kaum noch angewandt.
Dass der Mensch als Produkt seiner Vererbung und seines Milieus betrachtet wurde, klingt wieder einmal sehr resignierend. Man kann nichts gegen sein Schicksal, sein Unglück tun, es ist so wie es ist. Sicherlich hatten viele Menschen ihrer Zeit ein Problem mit der rasanten Entwicklung der Gesellschaft durch Maschinisierung, Industrialisierung, den Ausbreitungen der Städte. Bis dato hatte sich alles relativ langsam verändert – nun musste man Schritt halten mit dem neuen Tempo, oder man landete als armer alkoholisierter Verlierer in den Ghettos der Großstadt. All dies waren Auslöser der Entstehung der neuen Literaturepoche. Um das Kapitel – entgegen den Geflogenheiten der Naturalisten – jedoch positiv zu beenden, möchte ich zitieren: Alles Schlechte hat also auch was Gutes.
8 Expressionismus/Avantgarde (ca. 1910-1920)
Da sich dieses Buch dem zu frühen Tod von Dichtern des 19. und 20. Jahrhunderts widmet, sei hier erwähnt, dass die Selbstmordrate im angehenden 20. Jahrhundert überdurchschnittlich groß war. Gymnasiasten wählten den Freitod, da ihre Persönlichkeit zu stark war, um sich den „schematischen Anforderungen dummgrausamer Schulmeisterei im Zuchthaus der Schule“ unterwerfen zu können (Zitat aus „Geschichte der deutsch-sprachigen Literatur 1900-1918“, Peter Sprengel).
So gab es – um nur ein Beispiel zu nennen – in Preußen durchschnittlich 1 Schülerselbstmord pro Woche! Die kaiserliche Unkultur war eine Zeit, in der Technik und Sport mehr zählten als Prosa und Lyrik, die Literaten entschieden sich für eine freiwillige Entfremdung von dieser Form der Gesellschaft. Sie besannen sich zurück auf die Romantik, sehnten sich nach ihr in einer Zeit des Militarismus. Der Verleger Eugen Diederichs (1930 in Jena gestorben) war einer der Wegbereiter der Neuromantik (so druckte er u.a. die Anthologie „Die blaue Blume“ um 1902, eine Sammlung romantischer Märchen). Die romantischen Reminiszenzen der Werke des 20. Jahrhunderts waren nicht zu übersehen.
Der Begriff „Expressionismus“ tauchte erstmals im Zusammenhang mit der modernen französischen Malerei um 1911 auf. Kasimir Edschmids Vortrag von 1918 bezeichnete den „Expressionismus in der Dichtung“ als „intuitiv-ganzheitliche visionäre Kunst, als Neuschaffung der Welt und des Menschen“.
Die fatalen Auswirkungen des 1. Weltkriegs mit all ihren Opfern zeichnen die Epoche des Expressionismus extrem. Es gab Schriftsteller, die sich freiwillig zum Krieg gemeldet hatten – entweder aus patriotischen Gründen, falschen Vorstellungen, oder einfach nur, weil es ihnen eine gute Möglichkeit schien, zu sterben (ja, auch Selbstmörder haben sich unter den Soldaten befunden). Die Überlebenden waren nicht selten geisteskrank oder drogensüchtig geworden (Beispiel: Georg Trakl – er starb im ersten Kriegsjahr, nachdem er sich freiwillig gemeldet hatte und die schrecklichen Ereignisse auf dem Feld nicht verwandt; er starb als 27-Jähriger an einer Überdosis Kokain).
Eine Auswanderungsflut gen Amerika trieb die in Armut dahinvegetierenden Menschen fort in der Hoffnung auf ein besseres Leben. In Schweden war es 1915 immerhin ca. ein Fünftel der Bevölkerung, das seiner Heimat den Rücken zukehrte. Wasserknappheit (der deutschen Bevölkerung wurde empfohlen, sich nur einmal pro Woche die Füße zu waschen, ansonsten nur Gesicht und Hände) war an der Tagesordnung. Der italienischen Landbevölkerung war es aufgrund seiner Lebensmitteknappheit nur etwa einmal im Jahr, bestenfalls noch an besonderen Feiertagen, vergönnt, Fleisch zu essen. Und unter der Oberfläche kam es zu tiefgreifenden politischen Veränderungen. Soziale Unruhen und nationalistische Entwicklungen schürten das Feuer der Menschen an. Sie glaubten, durch Blutvergießen eine mächtige Nation aufbauen zu können, die den Zusammenschluss der einzelnen Völker (z.B. der Venezianer und Florenzer) zur Folge haben sollte.
Den Expressionismus zeichnen jedoch nicht nur negative Einflüsse aus: Die so genannte Belle Époque um die Jahrhundertwende war durchflutet von verschiedenartigsten Sprachen auf engem Raum, vielen Religionen, der Freude am Reisen. Die Erfindung der Wimperntusche, erster Haarfärbemittel (Loreal) und der Trend zum Picknick waren allgegenwärtig.
9 Wolf Graf von Kalckreuth (1887-1906)
Читать дальше