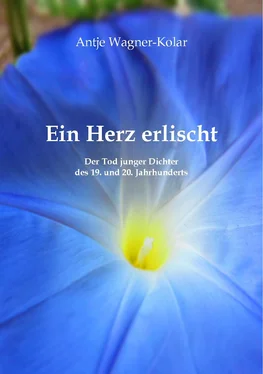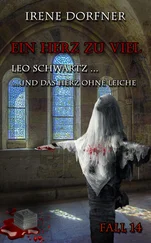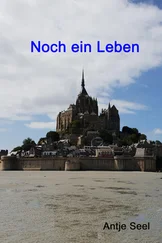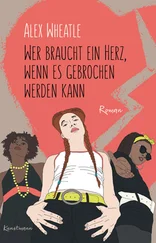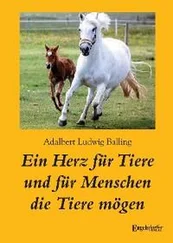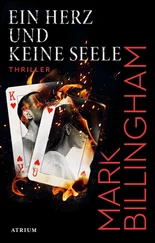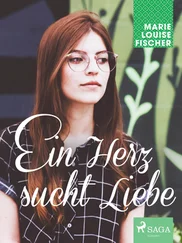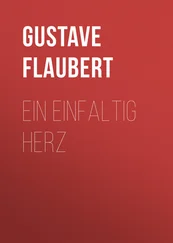Das Urwerk dieser Zeit ist wohl „Mimili“ von Heinrich Clauren (1815/16). Die eigentlich recht banale Erzählung einer Liebesgeschichte zwischen einem deutschen Offizier und einer Bergbauerntochter war ein Erfolg auf allen Ebenen und sorgte gleichzeitig für „Skandal“-Ausrufe und endlose Kritiken. Clauren würde den schlichten Roman lediglich durch Erotisierung wieder für die Leser interessant machen. Scheint aber funktioniert zu haben…
Die eigentliche Abgrenzung im Biedermeier von der noch vor kurzem vorherrschenden Zügellosigkeit formulierte Adalbert Stifter als „Sanftes Gesetz“ folgendermaßen:
„[…] So wie es in der äußeren Natur ist, so ist es auch in der inneren, in der des menschlichen Geschlechtes. Ein ganzes Leben voll Gerechtigkeit, Einfachheit, Bezwingung seiner selbst, Verstandesgemäßheit, Wirksamkeit in seinem Kreise, Bewunderung des Schönen verbunden mit einem heiteren gelassenen Sterben halte ich für groß: mächtige Bewegungen des Gemütes, furchtbar einherrollenden Zorn, die Begier nach Rache, den entzündeten Geist, der nach Tätigkeit strebt, umreißt, ändert, zerstört und in der Erregung oft das eigene Leben hinwirft, halte ich nicht für größer, sondern für kleiner, da diese Dinge so gut nur Hervorbringungen einzelner und einseitiger Kräfte sind, wie Stürme, Feuer speiende Berge, Erdbeben. Wir wollen das sanfte Gesetz zu erblicken suchen, wodurch das menschliche Geschlecht geleitet wird.“ (Vorrede zu Stifters „Bunte Steine“)
Dass Stifter sich 1868 das Leben nahm, indem er sich die Halsschlagader mit einem Messer durchschnitt, steht auf einem anderen Blatt Papier geschrieben und zeigt das Scheitern der „ewigen Harmonie“ auf seine eigene traurige Art.
Das resignierende Volk – es sah, dass es keinen Einfluss mehr auf die Staatsmächte ausüben konnte – entwickelte ein starkes Bedürfnis nach Ordnung, Ruhe und innerem Frieden, ersetzte das freie Gedankentum der Revolutionszeit durch Mäßigung und Unterwerfung. Die Liebe zum Alltäglichen, zum Kleinen, wurde in der Literatur verkörpert: Adalbert Stifters „Der Nachsommer“, Naturgedichte von Eduard Mörike oder Annette von Droste-Hülshoffs „Die Judenbuche“ sind typische Werke für diese Zeit, um hier nur einige zu nennen.
Hinter der konventionellen und harmoniegeschwängerten Hülle birst es jedoch schon, es rumort und am Ende des Biedermeiers wird die Märzrevolution stehen.

„Zimmerbild“ Leopold Zielcke (ca. 1825)
5 Vormärz (ca. 1840-1850)
Die literarische Epoche des so genannten Vormärzes ist als das Gegenstück zum Biedermeier, als Auflehnung gegen die Duldung der Staatsmacht zu betrachten. Viele politisch engagierte Schriftsteller lehnten die Lebensvorstellung des Biedermeier schlichtweg ab und engagierten sich für Meinungs- und Pressefreiheit ebenso wie für den aufkommenden Sozialismus (à la Saint-Simon: nur mit materieller Gleichheit ist auch eine persönliche Freiheit möglich) und die freie Liebe.
Was die Staatsmächte mit ihrer Unterdrückung und Überwachung des Volkes zu verhindern suchten, lösten sie praktisch selbst aus: das „Junge Deutschland“ forderte eine politische Meinungsbildung der Gesellschaft. Es veröffentlichte oppositionelle Texte und stachelte die Studenten seiner Zeit zu einer neuen Revolution an. Diese Auflehnung erstreckte sich über den deutschen Bund hinaus bis u.a. nach Österreich, Preußen, Ungarn, Italien, etc.
In den deutschen Fürstentümern nahm die Revolution in Baden ihren Anfang und griff innerhalb kürzester Zeit auf die übrigen Staaten des Bundes über. Erreicht wurde so die Aufhebung der Pressezensur und die Bauernbefreiung. Bis dato waren die Bauern immer noch verpflichtet gewesen, wie im Mittelalter Teile ihrer Einnahmen an Grund- und Leibherren abzugeben.
In diesen unruhigen Zeiten entstanden Werke wie Heines „Deutschland ein Wintermärchen“, „Dies Buch gehört dem König“ von Bettina von Arnim oder Georg Herweghs „Gedichte eines Lebendigen“ – ein polemisches Gegenstück zu den „Briefen eines Verstorbenen“ von Hermann von Pückler-Muskau. Auch Ludwig Feuerbachs Einfluss als Philosoph war im literarischen Vormärz nicht unerheblich. „Wissen statt Glauben“, so seine Devise. Der Vormarsch in der Forschung ging einher mit den Unruhen auf den Straßen, auch die Einmischung der Literaten in die Politik führte zu heftigen Diskussionen in der Gesellschaft. Die Frage, ob Politik etwas in der Kunst zu suchen hat, ist praktisch bis heute nicht beantwortet und weiterhin umstritten.
1848 scheiterte die Märzrevolution aufgrund der unterschiedlichen Ansichten der Liberalen und Demokraten, die sich kaum vereinen ließen. Als die Forderungen der Bauern erfüllt waren, kehrten diese der Bewegung ebenfalls den Rücken zu, so dass die Unterstützung von Seiten des Landvolks fehlte. Nicht zuletzt war die provisorische Regierungsbildung nach Friedrich Wilhelm des IV. Ablehnung der Krone durch „Volkes Gnaden“ zum Scheitern verurteilt. Sie hatte weder feste Einnahmen noch eine Verwaltung oder gar ein Heer. Damit verlief die Märzrevolution schon bald im Sande.
Mann der Arbeit, aufgewacht!
Und erkenne deine Macht!
Alle Räder stehen still,
Wenn dein starker Arm es will.
Deiner Dränger Schar erblasst,
Wenn du, müde deiner Last,
In die Ecke lehnst den Pflug,
Wenn du rufst: Es ist genug!
Brecht das Doppeljoch entzwei!
Brecht die Not der Sklaverei!
Brecht die Sklaverei der Not!
Brot ist Freiheit, Freiheit Brot!
(aus dem „Bundeslied für den Allgemeinen deutschen Arbeiterverein“, Georg Herwegh)
6 Realismus (ca. 1850-1890)
Der literarische Realismus war sehr gesellschaftskritisch angehaucht und ist als Werkzeug der nun Form annehmenden Objektivität in den Werken seiner Zeit zu sehen. Reale Ereignisse wurden aus Distanz beschrieben und hielten den Lesern den Spiegel der Gesellschaft vor. Diese Art von Gesellschaftsromanen war ebenso typisch für jene Literaturperiode wie es Novellen und auch bäuerliche Romane (z.B. „Waldheimat“ von Peter Rosegger) waren.
Die politischen Verhältnisse dieser Zeit – hier nur kurz angeschnitten, um die Auswirkungen zu verstehen – waren folgende: Seit 1848 regierte die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn unter dem österreichischen Kaiser Franz Josef, 1871 wurde Otto von Bismarck deutscher Reichskanzler. In den Zeiten des Umschwungs und der Neuorientierung entstanden Werke wie das „Kommunistische Manifest“ von Marx und Engels, Fontanes „Effie Briest“, Storms „Schimmelreiter“ und der teils autobiografische Roman „Der grüne Heinrich“ von Gottfried Keller.
Auch die Gründerjahre (1865-1873) fallen in diese Zeit. Die Epoche nach der Gründung des deutschen Kaiserreichs war geprägt von zahlreichen Entstehungen von Unternehmen und Aktiengesellschaften, das Schienennetz wurde ausgebaut, und immer mehr privates Kapital wurde in die Wirtschaft investiert. Die Elektrizität wurde erfunden. Kriege wurden geführt (z.B. der preußisch-österreichische 1866 und der deutsch-französische Krieg 1870/71), die Weltwirtschaftskrise nahm ihren Lauf.
Zu realisieren, dass die einstige Weltvorstellung der Romantik nichts (mehr) mit dem Alltag und seinem Werdegang zu tun hatte, ließ viele Künstler innerlich zerbrechen. Eine Welt brach buchstäblich zusammen, die Revolution war gescheitert. Nicht ohne Grund ist die Selbstmordrate während der Jahre 1856–1861 enorm gestiegen, die Zahl der Suizidalen extrem hoch, wie die folgende Statistik – hier ein Beispiel aus Frankreich – zeigt:
Statistische Tabelle der Selbstmorde in Frankreich 1856-61:
Читать дальше