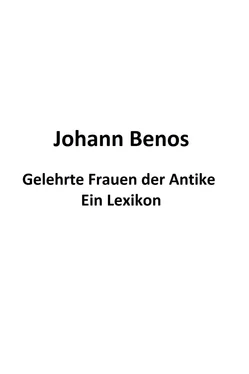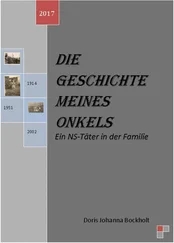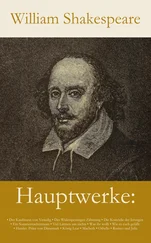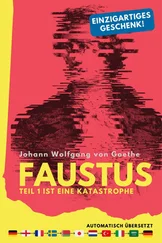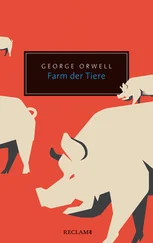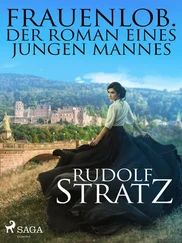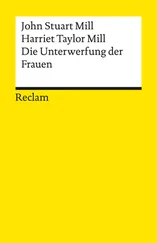Johann Benos - Gelehrte Frauen der Antike - Ein Lexikon
Здесь есть возможность читать онлайн «Johann Benos - Gelehrte Frauen der Antike - Ein Lexikon» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Gelehrte Frauen der Antike - Ein Lexikon
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Gelehrte Frauen der Antike - Ein Lexikon: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Gelehrte Frauen der Antike - Ein Lexikon»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Gelehrte Frauen der Antike - Ein Lexikon — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Gelehrte Frauen der Antike - Ein Lexikon», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
[1] Ebd. S. 137
2.3. Die gelehrten germanischen Frauen
Die Germanen hatten nach ihrem Eindringen in das römische Reich und der Gründung mehrerer Staaten im Westen ihre Sitten und Gebräuche mitgebracht und auch ihr Recht, das erst im Laufe der Zeit romanisiert wurde. So auch die Stellung der Frau. Sie war schlechter als im römischen Reich[1]. Die Frau soll nicht rechtlos in der Familie gewesen sein, aber sie war „rechtlich handlungsunfähig“, Sie durfte vor Gericht nicht ohne Vertretung erscheinen, ihr Vermögen nicht selbst verwalten und war im Erbfall benachteiligt.[2] Bei den Mädchen soll Sittenfreiheit erlaubt gewesen sein, aber für die Ehefrau galt absolute Treue. Vom Mann allerdings wird sie nicht verlangt. Vergewaltigung einer Frau wurde aber streng bestraft aber auch die Verletzung ihrer Schamhaftigkeit. Der Frau war fast entmündigt. Sie stand ein Leben lang unter der Muntgewalt erst ihres Vaters und dann ihres Ehemannes. Diese Muntehe wurde zwischen dem Vater und dem Ehemann vereinbart und war legitim. Vor der Ehe bestand die Verlobung. Löste der Bräutigam die Verlobung wurde er mit einem Bußgeld bestraft. Brach die Verlobte die Treue, so wurde sie bei manchen Germanen zumTode verurteilt. Eine weitere Art der Ehe ohne Dos war die Friedelehe und beruhte auf der Zuneigung der Ehepartner. Die Dos der Germanen war die Schenkung des Mannes an seine Frau, aber vor der Ehe. Sie war nicht ihre Mitgift wie bei den Römern und legitimierte die Ehe. Eine weitere Form des Zusammenlebens der Geschlechter war das Konkubinat, das eigentlich die Kirche nicht erlaubte und die Männer meistens neben der Muntehe betrieben. Einige Germanen-Völker verbesserten später die Lage der Frau unwesentlich, z.B. wurde die Frau bei Ehebruch verstoßen, aber nicht getötet. Die Frauen gingen, um dem Munt zu entkommen, in die Klöster, die nicht so strenge Regeln hatten wie die heutigen, und einige waren geschlechtlich gemischt. Nur dort konnten sich die Frauen frei entfalten, allerdings bis nur zu einem gewissen Grad. Auch mächtige Fürstinnen und Königinnen lebten freier.
Es sollen mehr Frauen als Männer am geistigen Leben des frühen Mittelalters beteiligt gewesen sein.[3]
[1] Ennen, S. 33
[2] Ebd., S. 34
[3] Ennen, S. 79
2.4. Die Frau in Europa außerhalb der griechisch-römisch-germanischen Kultur
In den anderen europäischen Ländern (Skandinavien, Osteuropa) gab es in der Antike keine große gebildete Schicht in der Bevölkerung. Wer sich bilden wollte ging zu den Griechen oder Römern und blieb auch dort. Erst seit dem 10. Jh. n.Chr. beginnt langsam der geistige Aufschwung. Eine Ausnahme bildet der angelsächsische Raum, wo es bereits seit dem 8. Jh. gelehrte Frauen gab, die allerdings in Latein schrieben.
2.5. Die Hebräerinnen
Nach der Rückwanderung der Hebräer in das Land Kanaan vermischten sie sich nach langen, verlustreichen Kämpfen mit den Einheimischen, bzw. gingen die Kanaaniter in den Hebräern auf und bildeten eine Nation.
Auch bei ihnen war der Vater das Oberhaupt der Familie, wie bei vielen Völkern, aber mit einem Unterschied zu den Europäern. Ihm oblag die Erziehung der Kinder, vor allem die der Söhne. Hochschätzung der Nachkommenschaft, vor allem der männlichen, galt als Gebot. Die Söhne verbürgten dem Vater die Unsterblichkeit.[1] Die Töchter dagegen waren die Sklavinnen des Vaters, und er konnte sie schon vor der Pubertät als Sklavinnen verkaufen.[2] Frauen sollen in der Anschauung der Hebräer schwächer und minderwertiger sein. Sie würden angeblich aus der linken Hode des Mannes stammen, die Knaben aus der rechten. Die linke hielt man für kleiner, schwächer und minderwertiger.[3] Die Mädchen der wohlhabenden Familien wurden zuhause eingesperrt und hatten keine Gelegenheit, Männer kennenzulernen. Wenn sie erwachsen wurden, hatten sie den Mann zu heiraten, den der Vater für sie ausgesucht hatte. Nach der Hochzeit verließen sie ihre Familie und gingen zu der des Ehemannes. Ein Ehevertrag war üblich. Das Heiraten von Nebenfrauen war eine gewöhnliche Angelegenheit. Monogam waren nur ärmere Männer. Die verheiratete Frau spielte in der Familie nur dann eine größere Rolle, wenn sie Mutter wurde, je mehr Kinder desto höher ihr Ansehen. Kinderlosigkeit empfand man als großes Unglück.[4] Trotz dieser Stellung der Frau gab es auch starke Persönlichkeiten wie Sara, Rahel, Ruth, Esther u.a., die eine wichtige Rolle im Staat spielten. Sie waren aber keine Gelehrte. Im Alten Testament wird bis auf Debora keine andere gelehrte Frau erwähnt.
Die Wertung der Leiblichkeit, vor allem der Sexualität, war ambivalent. Vielweiberei und Askese, Leibesfülle und Enthaltsamkeit waren die Regel. Der Jahwe-Monotheismus und der Glaube an ein anderes Leben nach dem Tode, beeinflussten das tägliche Leben stark. Auch die frühere nomadische Vergangenheit hatte beim Volk die sippenhafte bzw. familiäre Solidarität bewahrt.[5]
[1] Maier, S. 150
[2] Durant, Bd. II., Judäa, Persien, Indien, S. 59
[3] Ebd.
[4] Maier, S. 151
[5] Ebd., S. 152
2.6. Die Inderinnen der Antike
Bei diesen drei großen Nationen, die vor unserer Zeitrechnung eine hohe Kultur entwickelten, hatten die Frauen die gleiche Stellung wie bei den Hebräern und zwar in verschiedenen Variationen. Inderinnen mussten sich nach dem Tode ihres Mannes verbrennen lassen. Und trotzdem gab es zahlreiche Dichterinnen, deren Namen wir aber nicht kennen.
2.7. Die Chinesin in der Antike
Mit dem Auftreten des Konfuzianismus verschmolz der alte Ahnenkult zu einer Einheit. Trotz entgegengesetzter Strömungen in den Jahrhunderten blieben für die Chinesen die gleichen moralischen Grundsätze bestehen. Chinesen konnten sich ein Leben ohne einen Moralkodex nicht vorstellen; sie glaubten, ohne ihn käme das Chaos. Die Ehe beschränkte sich auf das Zeugen von Kindern. Man betete täglich, Söhne zu bekommen, und die Ehefrauen waren beschämt, wenn sie keine hatten.[1] Der Mann brauchte einen Sohn, damit der ihm nach seinem Tode Opfer darbrachte. Frauen nicht? Töchter zu haben, war weniger erwünscht. Wer zu viele hatte, ließ das Baby am Straßenrand liegen. Die Kinder wurden von der Mutter und anderen weiblichen Angehörigen erzogen und im weiblichen Teil des Hauses bis zu ihrem 7. Lebensjahr behütet. Danach wurden die Knaben in eine Privatschule geschickt und durften ab dem 10. Lebensjahr nur mit Männern oder Kurtisanen verkehren. Die Mädchen der Wohlhabenden wurden streng bewacht, denn Keuschheit galt für chinesische Mädchen als ihr höchstes Gut. Manche begingen sogar Selbstmord, wenn sie ein Mann nur zufällig im Verbeigehen berührte, weil sie nun nicht mehr „unberührt“ waren.[2] Frauen waren voreheliche Beziehungen strengstens verboten, andernfalls landeten sie, wie viele der armen Mädchen auch, im Bordell, und davon gab es zahlreiche in jeder Stadt. Für einen Mann war es unehrenhaft, unverheiratet zu bleiben aber seine Heirat hatte nichts mit Liebe zu tun. Romantische Liebe gab es nur in Romanen. Es gab sogar Beamte, die darauf achteten, dass jeder Mann über 30 J und jede Frau über 20 J verheiratet sein musste. Oft sahen sich die Brautleute in der Hochzeitsnacht zum ersten Mal. Die Frau wohnte im Haus des Vaters des Ehemannes und war praktisch rechtlos und Sklavin ihres Ehemannes. Nach seinem Tode bestimmten ihre Söhne über sie. Frauen erhielten nur ausnahmsweise eine Bildung. Man schätzt, dass von 10.000 Frauen nur eine des Lesens und Schreibens kundig war.[3]
Trotzdem, diejenigen die das konnten, schrieben Verse, die einzige Möglichkeit, der Eintönigkeit und der Traurigkeit ihres Lebens wenigstens kurzzeitig zu entkommen. Das Schreiben und Lesen war auch ihre einzige Möglichkeit, sich geistig zu betätigen. Gewiss sind weder alle Gedichte Kunstwerke, noch waren die Frauen, die sie schrieben Gelehrte. Auch ist ihre Zahl im Vergleich zu den Millionen Chinesinnen aus den oben genannten Gründen verschwindend klein, weshalb ich auch nur sehr wenige Gelehrte finden konnte.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Gelehrte Frauen der Antike - Ein Lexikon»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Gelehrte Frauen der Antike - Ein Lexikon» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Gelehrte Frauen der Antike - Ein Lexikon» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.