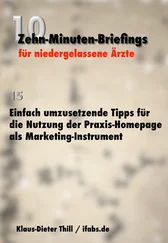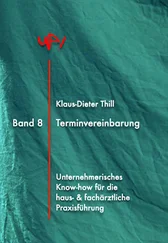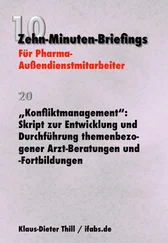Aus diesem Leben in Freiheit sollte ich jäh herausgerissen werden und einen Kindergarten besuchen. Ob das wohl gut ging? Es wurde nicht gut!
Eines Morgens stand ich vor einem flachen Haus. Einem neuen, für die damalige Zeit modernen, schnell gebautem Haus. Im Hof ein Sandkasten und Spielgeräte zum Klettern. Auf der geräumigen Terrasse luden kleine Tische und Stühle zum Spielen ein. Es war wie im Märchen, bei Schneewittchen und den sieben Zwergen.
Schöne, zweckmäßig eingerichtete Zimmer, Spielräume, Waschräume mit Duschen zwei lange, saubere Korridore machten einen guten Eindruck.
Freundliche Erzieherinnen, feinstes Essen mit viel Obst und Gemüse zum Mittag, sowie heiße Milch oder Schokolade am Nachmittag erwarteten mich. Es war wie im siebenten Himmel.
Nur über einen, alles entscheidenden Fehler gibt es zu berichten: Es begann ein Leben nach der Uhr, was bei der großen Anzahl von Knirpsen nicht zu vermeiden war. Mein Innerstes sträubte sich. Den eigenen Willen der Gemeinschaft unterordnen, ständig aufpassen, was die Erzieherinnen sagten, um das beste Spielzeug kämpfen... Da versagte der Körper den Dienst, weil die Seele streikte - ich wurde krank. Der Arzt konnte nichts finden. Also wurde der Versuch "Kindergarten" mehrfach wiederholt, stets mit dem gleichen Ergebnis, bis meine Eltern zu der Einsicht kamen, dass ich zu Hause, in der gewohnten und geliebten Umgebung am Besten aufgehoben war.
So kam es, dass ich in der Gemeinschaft der Kinder unserer Straße, in der nahen Natur wohl behütet aufwuchs.
Unser Haus befand sich in unmittelbarer Nähe des alten Schlachthofes, der 1898 sehr großzügig erbaut (und nach der Wende fast vollständig, zu Gunsten eines Supermarktes abgerissen) wurde. Er ist ein Industriebau mit guter Architektur. Weniger gut war der Geruch, besser der Gestank, wenn der Ostwind wehte. Unser Haus hatte auch ein gutes Aussehen (siehe Foto). Es wurde 1908-1912 von meinem Urgroßvater und dessen Schwager gebaut, hatte sechs Wohnungen und ein später ausgebautes Dachgeschoss. Äußerlich einfach gestaltet, in grau gehalten, fielen nur die Messingbeschläge der Haustür und der in der Nazizeit angemalte und danach mehrfach ergebnislos überpinselte Hinweis “Löschwasserentnahmestelle“ auf.
Im Inneren war es bürgerlich. Wandgemälde, Windfangtüren, ebenfalls mit Messingbeschlägen und geschliffenem Glas, gedrechselte Treppengeländer und buntes Glas in den Flurfenstern komplettierten diesen Eindruck. Nur die Toilettentüren auf den Zwischenetagen zeigten, dass es ein normales Haus war. Die Wohnungstüren waren mit Riffelglas verziert und hatten noch ein normales, einfaches Türschloss, welches mit einem einfachen Dittrich zu öffnen war. Jede Familie hatte ihren eigenen geräumigen Keller und einen Verschlag auf dem Dachboden. Vom Hof aus konnte man das Waschhaus betreten, in dem ein mit Kohle zu beheizender Waschkessel und ein gusseiserner Ausguss vorhanden waren. Zwei Wasserhähne komplettierten die Ausstattung. Inmitten der Waschküche stand ein Holz-Waschzuber auf einem Bock, der nur über drei Füße verfügte. In irgendeiner Ecke lag eine Wäscherolle herum, die den Frauen zum Auswringen der Wäsche diente. Diese wurde dann an den Waschzuber angeschraubt. Zweimal im Monat war “Große Wäsche“ angesagt. Dann sollte man sich aus dem Staube machen, sonst konnte man mindestens eine Stunde die Kurbel der Wäscherolle bedienen, was zwar nicht Kräfte raubend, aber vor allem sehr langweilig war.
Es gab aber auch bessere Momente, wo wir gerne in die Waschküche gingen und zwar dann, wenn aus Zuckerrübenschnitzel Sirup gekocht wurde. Das war ein langwieriger Prozess, der mit aufwendigem Umrühren der klebrigen Masse verbunden war. Dazu waren wir nicht zu gebrauchen, aber beim Naschen waren wir zur Stelle. Vor dem abschließenden Kessel schrubben wurden wir nicht geschont.
Auch nicht verschont wurden wir, wenn wir nach dem abwasserverseuchten Fluss stinkend und schwarz wie die Raben aus unseren “Jagdgründen“ kamen. Dann wurde die ganze Bande mit einem Handtuch ausgerüstet und der Kessel angeheizt. Wir waren es dann, die geseift und abgeschrubbt wurden. Das war ein Spaß. Es wurde gespritzt, gealbert und gebrüllt, eine wahrhafte Wasser- und Reinigungsorgie. Anschließen trollte sich ein jeder, mit einem Handtuch um die Hüfte und die “Dreckklamotten“ über dem Arm nach Hause. So hat meine Mutter den Eltern meiner Spielkameraden eine Menge Arbeit abgenommen.
Meine Freunde von damals sind heute Facharbeiter, Ingenieure und sogar Wissenschaftler. Einige (wenige) von ihnen habe ich aus den Augen verloren, denn sie gingen mit ihren Eltern in den goldenen Westen (sprich: Trizonesien) und blicken sicher heute mitleidig oder auch mit Hass auf die Menschen im Neu-Fünf-Land. Vielleicht denken sie auch, dass wir ständig jammernde Nichtsnutze sind, die nie aus dem Mist herauskommen werden. Vielleicht aber denken sie auch noch gern an ihre Kindheit und an ihre alte Heimat, mit all ihren Vorzügen und Nachteilen, zurück.
Für uns Kinder war es immer wieder etwas besonders, wenn die Sowjetsoldaten ihre Schweine zum Schlachten brachten - jedes der Regimenter verfügte über ein Bataillon Schweine - zur Selbstversorgung. Sie kamen mit Pferdewagen ungewöhnlicher Bauart im Volksmund “Panjewagen“ genannt. Auf denen standen aus Latten grob gezimmerte Verschläge, in denen die Schweine grunzten. Dutzende dieser Wagen standen vor dem Schlachthof, in der Nähe unseres Hauses, indessen die Vorgesetzten die Papiere ordneten. Während die Schweine geschlachtet und geviertelt wurden, entlausten die Soldaten ihre struppigen Pferde. Eigens dafür hatte man kleine Betonkäfige gebaut. Dort wurden die sich sträubenden Pferde rückwärts hinein geschoben. Die Eisentür, die den Tieren nur gestattete, den Kopf durch eine mit Sackleinwand bespannte Luke, zu stecken, wurde geschlossen. Auf die Tiere schüttete man von der Decke des Verschlages weißes, nach Chlor riechendes Pulver. Schnaubend standen die Tiere ca. 20 Minuten, dann wurden sie herausgeführt, gestriegelt und vom getöteten Ungeziefer befreit.
Wir bettelten oder vertauschten Zigaretten (natürlich von Vaters Vorräten genommen) gegen Abzeichen, Käppis und anderes mehr. Die Soldaten waren immer sehr nett zu uns. Es wurde viel gelacht. Für diese Soldaten waren wir wie eine Brücke in die Heimat, die sie schon seit Jahren nicht gesehen hatten oder sehen werden. Sicher dachten sie, wenn sie mit uns spielten, an ihre Kinder oder an ihre Geschwister, denn viele Soldaten hatten selbst noch ein wahres Milchgesicht. Sie bewegten sich genau wie wir, und zeigten kindliche Freude über die kleinen Geschenke von uns, die wahrlich nicht wertvoll waren. Ihre Stimmung konnte aber auch sehr schnell umschlagen, wie wir es noch erleben sollten. Es begann so: In dem Jahr, in dem ich in die Schule kommen sollte, im Frühsommer fand ein eigentümlicher Umzug statt, aber nicht wie es immer zum 1. Mai oder im Oktober der Fall war. Die Demonstranten hatten keine fröhlichen Gesichter und man scherzte auch nicht. Es gab auch keine Unruhen am Rande des Umzuges. Viele Menschen mit roten Fahnen versammelten sich vor dem Rathaus. Die festlich geschmückten Fahrzeuge fehlten und die Menschen waren aufgeregt, teilweise zornig, jedenfalls nicht so, wie ich es von anderen Umzügen kannte. Von der Tribüne wurden hektische Reden gehalten. In den Seitenstraßen standen vereinzelt Panzer. Schön, dass die „Sowjetnis“ auch dabei sind, dachten wir und kletterten wie immer auf ihre Fahrzeuge. Ungewöhnlich, kein Lächeln war in den Gesichtern der Soldaten zu sehen. Aufmerksam beobachteten sie die Menge. Der Kommandant aber war behände aus der Turmluke gestiegen und holte uns von seinen Panzern. Nicht unfreundlich, aber keinen Widerspruch duldend, befahl er:
"Domoi! Mama, domoi!" Mit betretenen Gesichtern trollten wir uns. Aus sicherem Abstand betrachteten wir das Geschehen. Bald löste sich die Versammlung auf und die Panzer formierten sich zu einer Reihe und zogen mit brüllenden Motoren und klirrenden Ketten davon.
Читать дальше