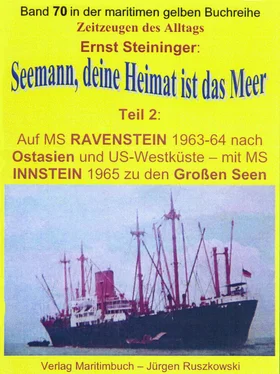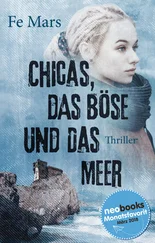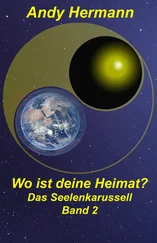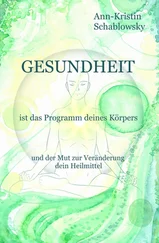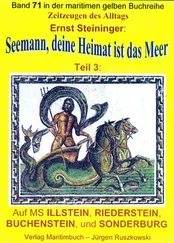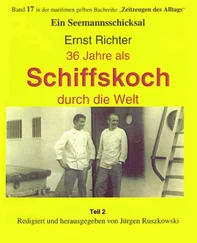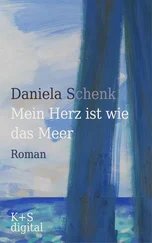Aber dann, 1857, da war es so weit, da wurden endlich Nägel mit Köpfen gemacht. Alois Negrelli, Ritter von Moldelbe und Erbauer der Semmering-Bahn – zu seiner Zeit ein technisches Prunkstück – wurde nach Vorlage seiner Detailplanung Generalinspektor des Mammutprojektes. Doch hat ihm leider bereits ein Jahr später, noch vor Beginn der eigentlichen Arbeiten, der unberechenbare Tod alle seine technischen Pläne frühzeitig aus der Hand genommen. Diese Pläne flatterten dann prompt auf Ferdinand de Lesseps Schreibtisch.
Mitsamt den Plänen hatte sich Herr Lesseps aber auch jede Menge Probleme und Ärger eingehandelt. Nicht nur, dass es vor Ort an jeglichem Material fehlte. So musste z. B. vor dem eigentlichen Kanalbau erst einmal ein Süßwasserkanal zur Baustelle verlegt werden. Zwischendurch wütete die Cholera unter den Arbeitern, die verständlicher Weise erstmal alles stehen und liegen ließen und lieber das Weite suchten. Zur bautechnischen Misere gesellten sich, nachdem es nicht so richtig voran ging, auch noch finanzielle Schwierigkeiten. Nein, Ferdinand war da sicher nicht zu beneiden, und ich denke, dass er nach der Fertigstellung des Kanals im November 1869 bereits so weißhaarig war, wie er uns Nachgeborenen aus dem Lexikon bekannt ist.
Baukosten: (laut Wikipedia) Die Baukosten des Kanals beliefen sich auf etwa 19.000.000 Pfund Sterling, von denen 12.800.000 durch Aktienzeichnungen aufgebracht wurden, während den Rest der Khedive deckte. Letzterem kaufte England 1875 die übernommenen, noch unplacierten Aktien (176.602 Stück im Wert von 3.500.000 Pfund Sterling) ab. Bis Ende 1884 wurden mit Einschluss der Verbesserungen für den Kanal 488.000.000 Franken verausgabt, wogegen die Aktiva 76.700.000 Franken betrugen.
Einnahme und Ausgaben. Die Einnahmen der Gesellschaft erbrachten 1872 zum ersten Mal einen Überschuss von 2.000.000 Franken, der 1887 auf 29.000.000 Franken stieg. Die Einnahmen bezifferten sich auf 60.500.000 Franken, die Ausgaben auf 30.800.00 Franken.
Wirtschaftliche Bedeutung. Wirtschaftlich profitierten vom Sueskanal vor allem die Seehandelsmächte der Mittelmeerländer, die nun wesentlich schnellere Verbindungen als die Nord- und Westeuropäischen Seehandelsnationen, wie Großbritannien oder Deutschland, in den nahen und fernen Osten hatten. Größter Profiteur im Mittelmeerraum war Österreich-Ungarn, das sich nicht zufällig an Planung und Bau des Kanals beteiligte. Die größte österreichische Seehandelsgesellschaft, der Österreichische Lloyd, erlebte nach der Fertigstellung des Kanals eine rasante Expansion. Die Gesellschaft war Gesellschafter an der Compagnie Universelle du Canal du Sues, deren Vizepräsident der Lloyd-Mitbegründer Pasquale Revoltella war.
So, das war es, was ich vor allem noch abgeschrieben haben wollte: dass nun auch dem allerletzten unwissenden Leser endlich klar wird, was die Seehandelsnation Österreich-Ungarn einstmals für eine bedeutende Rolle auf den Weltmeeren spielte. Und dass man mir niemals wieder mit der saublöden Bemerkung komme: „Sie, Sie als Österreicher, wie kommen denn Sie zur Seefahrt?“
Zum Thema „Der Suez-Kanal in der politischen Auseinandersetzung“ gäbe es noch allerhand Interessantes abzuschreiben. Aber der mündige Leser kann ja selbst jederzeit „googeln“, und ich erspare mir weiteres „Gscheitwaschln“. Nur noch soviel: 1967, bei Beginn des „Sechstagekrieges“, hätte der Krieg auch mich beinahe erwischt. Die „RIEDERSTEIN“, auf der ich damals gemustert war, war das allerletzte Schiff, das die Kurve vor der Schließung des Kanals gerade noch so eben hinbekam. Wir standen schon kurz vor dem südlichen Kanalende, als der Kapitän endlich über Funk die Order bekam, das Schiff augenblicklich auf Gegenkurs zu drehen. Nun war es nicht so, dass wir überhaupt nichts über die aktuelle Kriegsgefahr in Nahost gewusst hätten. Bereits bei unserer Abfahrt im australischen Freemantle wurden Überlegungen laut, ob man deswegen den Kurs doch nicht lieber über die Kapstadt-Route absetzen sollte. Angesichts der Geographie und der politischen Weltlage war diese Überlegung gar nicht so abwegig. Da aber unser erster Bestimmungshafen Genua war, entschied man sich in Bremen für die Sueskanal-Route. Dass wir letztlich dann nicht im großen Bittersee festsaßen, so wie eine ganze Menge Schiffe vor uns, verdankten wir wohl der Bunkerverzögerung in Djibuti (da standen die Schiffe, bildlich gesehen, an der Zapfstelle Schlange). Dieser Zeitverlust war schließlich das ausschlaggebende Kriterium für unser „Zuspätkommen“. Aber in diesem Fall wurden wir für unser „Zuspätkommen“ nicht bestraft, wenngleich die dadurch erzwungene Umrundung Afrikas auch nicht gerade in unserem Sinne war. Als wir dann letztendlich, vermutlich mit dem letzten Tropfen Treibstoff, Genua erreichten, waren ganze 44 Seetage vergangen. Aber immerhin, wir waren angekommen. Ein HAPAG-Schiff, das einige Stunden vor uns die Stadt Suez und damit den Kanal noch erreicht hatte, lag stattdessen – im trauten Verein mit anderen Schiffen – für die nächstfolgenden Jahre im Bittersee fest. Das war sicherlich bitter, sehr bitter für Reederei und Besatzung, die dann irgendwann ausgeflogen wurde…
Die Sperrung des Kanals, die von 1967 bis 1975 andauerte, war dann auch besonders für die westeuropäischen Industriestaaten sehr bitter. Diese öldurstigen Staaten hatten nicht mehr genug Nachschub von dem schwarzen Saft, der die Wirtschaft in ihrem Innersten zusammenhält und Reichtum und Wohlstand bedeutet. In Österreich z. B. durften die Autos – die heiligen Kühe der Wohlstandsbürger – entsprechend ihrem Kennzeichen nur noch jeweils an geraden oder ungeraden Tagen auf die Straße. Das muss man sich mal vorstellen und – auf der Zunge zergehen lassen… Was für einen Aufschrei würde so eine Maßnahme heutzutage wohl auslösen in einem Land wie zum Beispiel Deutschland? In einem Staat, in dem die Autoindustrie das Sagen hat! Wo wider jede Vernunft in dummdreister Weise freie Fahrt für freie Bürger propagiert wird!
Nun, die Wirtschaft wusste sich zu helfen. Onassis machte es vor, und die Öltanker, nun in ihrem Wachstum durch keine Sues-Norm mehr behindert, wuchsen sich zu ihrer heutigen Größe aus. Allerdings nur äußerlich. Innerlich blieben sie das, was sie immer schon waren: Dünnblechige Konservenbüchsen mit einem Hilfsmotor. Die negativen Auswüchse dieser Technik einschließlich der verheerenden „Einsparungs-Philosophie“ sind ja inzwischen wohlbekannt; deshalb will ich mir und Ihnen weitere Kommentare dazu ersparen. Soviel noch: Inzwischen wird ja viel über so genannte „doppelwandige“ Tanker geredet, wohl, um die Öffentlichkeit zu beruhigen. Wie ernst dieses Vorhaben auch immer sein mag, bis es zur allgemeinen praktischen Aus- und Durchführung gelangt, werden sicherlich wieder viele Jahre vergehen. Vielleicht gar so viele, dass es schlussendlich gar nicht mehr nötig sein wird, weil das „schwarze Gold“ inzwischen versiegt ist…
Was mir sonst noch zur Kanalfahrt „an sich“ einfällt? Na, dass sie z. B. für einen Stunde um Stunde am Steuer stehenden Rudergänger stinklangweilig ist. Aber nicht nur für den Rudergänger, der sich ja immerhin auf den aktuellen Kompassausschnitt konzentrieren muss. Der Lotse hingegen, der ja sozusagen „Das Ganze“ hat – der Kapitän kann sich daher ganz beruhigt in seine Kabine verkrümeln – muss also auch das Ganze im Auge behalten. Das heißt auch, dass der Abstand zum Vorderschiff penibel eingehalten werden soll. Was nicht immer gelingt, weil ja jedes Schiff, so wie die störrischen Esel, seine eigene, eigenwillige Gangart hat. Im Sueskanal ist es genauso wenig erlaubt – genauso wenig wie in jener Hölle, in der die armen Sünder bis Oberkante Unterlippe in der Scheiße stehen – Wellen zu machen. Das bekommt der sandigen Uferböschung nicht. Deshalb sind alle Schiffe im Konvoi zur einheitlichen Schleichfahrt verurteilt. Aber gerade so ein kontinuierliches Dahinschleichen mochte unser „Schnelldampfer“ mit seinen drei Propellern gar nicht. Mit allen dreien im Einsatz war auch noch das „Ganz langsam“ am Maschinentelegrafen um ein Weniges zuviel. Wurde nur die Mittelschraube benutzt, war die Fahrt wieder um ein Weniges zu langsam. Den gehörigen Abstand von – sagen wir mal – 200 m bis 300 m (diese Angabe ist ohne Gewähr) konkret durchzuhalten, war daher so gut wie unmöglich. Das machte es eben notwendig, die Marschfahrt in gewissen Abständen immer wieder zu korrigieren.
Читать дальше