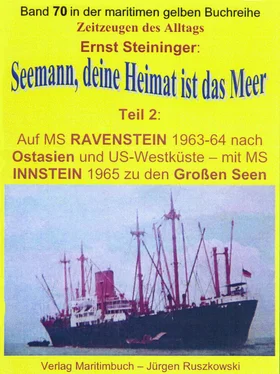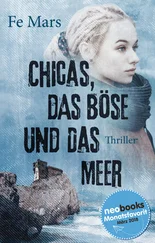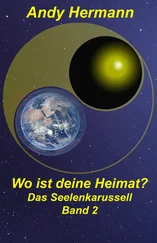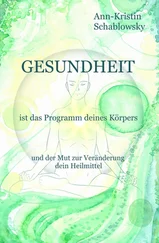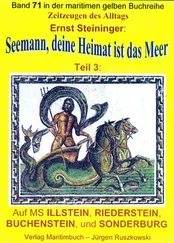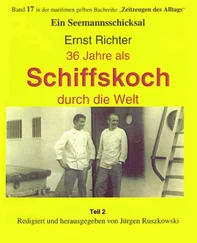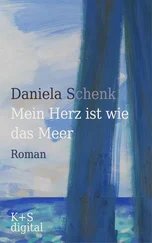Damals wie heute werden die Schiffe in langen Konvois durch den Kanal geschleust. „Geschleust“ ist bildlich zu verstehen; zwischen dem Mittel- und dem Roten Meer gibt es keinen nennenswerten Höhenunterschied, so dass der Kanal ohne Schleusen auskommt. Die künstliche Rinne wird von drei Seen unterbrochen. Im größten davon, dem Bittersee, wurden die gegenläufigen Konvois aneinander vorbei geführt. Das klappte nicht immer reibungslos. In so einem Fall hatten die Schiffe des einen Konvois so lange zu ankern, bis die Kamelkarawane, pardon, der Schiffskonvois in endlos langer Prozession endlich vorbeigezogen war. So war das damals jedenfalls üblich.
So eine Liegezeit konnte sich über viele Stunden hinziehen. Nachts fiel das ja nicht so sehr auf, aber tagsüber, da heizte sich das reglos und schutzlos in der gnadenlos heißen Sonne liegende Schiff mit seinem schwarz gestrichenen Rumpf und Hauptdeck wie eine Kochplatte auf.
Warte-Rast auf dem großen Bittersee
Um die edlen Häupter der Offiziere und gegebenenfalls auch die der Passagiere vor Überhitzung zu schützen, durften wir in den oberen Mittschiffsetagen Sonnensegel setzen. Die spendeten immerhin Schatten, wenngleich sie keine Lüftung ersetzen konnten. Das mit der Lüftung war in jenen Tagen noch eine sehr magere Angelegenheit. Die riesigen Windhutzen, diese langhalsigen Stielaugen, waren nur bei Fahrtwind von Nutzen. Außerdem waren sie fast ausschließlich zur Belüftung der Laderäume und des Maschinenraumes gedacht. Zwar gab es auf moderneren Schiffen als dem Schiffsaurier RAVENSTEIN auch schon eine Kabinenbelüftung, aber eben nicht auf unserem alten „Viermaster“. Da mussten wir uns noch mit einem sogenannten „Miefquirl“ begnügen; falls er nicht gerade kaputt war. Um überhaupt Frischluft in eine Kabine der unteren Decks zu bekommen, bediente man sich eines halbrund gebogenen, länglichen Blechs. Dessen eines Ende wurde am offenen Bulley befestigt, während das andere Ende wie ein weit abstehendes Ohr in den geneigten Wind ragte. Ja doch, der Wind musste schon „geneigt“ sein, denn lag man mit seiner Kammer in Lee, dann konnte man nur achselzuckend sagen: „Oje!“
Aber das war noch lange nicht das einzige negative Kriterium. Auch bei Starkwind, Unwetter, Seegang, bei voll beladenem Schiff funktionierte diese Belüftungsvorrichtung meist nicht. Tja, nicht selten auch verursachte sie böses Blut zwischen den beiden Nutzern ein und derselben Kammer, besonders dann, wenn durch Unachtsamkeit wieder einmal die halbe Bude abgesoffen war. Bei andauerndem Schlechtwetter und ganz besonders in den Tropen war es in diesen Unterkünften kaum auszuhalten. Also bastelte ich mir nach der Erfahrung auf dem „Bratsee“ eine stabile Hängematte aus einem „organisierten“ Segeltuchrest und schlief darin, wann immer es mir möglich war, völlig im Freien, im Sonnensegelgestänge des Poophauses auf dem Achterdeck.
Vielleicht sollte ich jetzt auch einmal etwas über den Kanal selbst schreiben. Also gut, schauen wir ins Internet: Der 163 km lange Sueskanal ist ein künstlicher Wasserweg vom Mittelmeer zum Roten Meer über die nur 113 km breite Landenge von Sues. Er verbindet die zwei Hafenstädte Port Said und Sues miteinander. Seit seiner Errichtung ist es nicht mehr notwendig, den ganzen Kontinent Afrika zu umrunden, um auf den Seeweg von Europa nach Asien zu fahren.
Der Kanal wurde von der französischen Sueskanal-Gesellschaft unter der Leitung von Ferdinand de Lesseps erbaut. Die Pläne dafür entwarf bereits ab 1838 der österreichische Eisenbahnpionier Alois Negrelli. Für die Schifffahrt wurde der Kanal am 16. November 1869 freigegeben.
Dass die ersten brauchbaren Pläne für einen Kanal, der auch den Ansprüchen der sich entwickelnden Dampfschifffahrt genügen sollte, von einem Österreicher stammten, das wusste ich natürlich. Hatte ich doch mit Ingenieur Negrelli und mit Oberförster Ressl, dem Erfinder der Schiffsschraube, bei den häufigen Streitereien mit meinen unwissenden Kollegen über Österreichs ehemalige Kompetenz auf den Weltmeeren zwei starke Trümpfe im Ärmel. Dass aber auch der gefürchtete Zuchtmeister der deutschen Kleinstaaten, der österreichische Kanzler Metternich, bereits 1843 Interesse an dem Bau eines Kanals bekundet hatte, das erfahre ich erst jetzt dank Wikipedia.
Ja, genau besehen, machte österreichisches Kapital – oder vielleicht doch eher ungarisches – den Bau dieses Mammutprojektes erst möglich. Bitte sehr, ich zitiere aus Wikipedia: Am 25. April 1859 begannen in Port Said, am Nordende des Kanals, die Bauarbeiten nach Negrellis Plänen. Die zu bewältigenden Schwierigkeiten waren ungeheuer groß. Alles Material, alle Werkzeuge, Maschinen, Kohle, Eisen, jedes Stück Holz musste aus Europa geholt werden. Der Hauptlieferant für Bauholz war der Holzlieferant Leopold Popper (1820 bis 1886) aus Bitscha (heute Bytca) im Norden des Königreichs Ungarn, heute Slowakei. Das Holz wurde in den umliegenden Wäldern des Komitats Trentschen geschlagen und per Floß die Waag und dann die Donau abwärts transportiert. In Galatz wurde das Holz auf Seeschiffe verladen und durch die Dardanellen nach Port Said verschifft. Der Lieferant wurde zum ungarischen Baron geadelt. 1872 wurde er zum österreichischen Freiherren mit dem Prädikat Freiherr von Podhragy geadelt. Darauf verlegte er den Hauptsitz seiner Firma nach Wien.
Na bitte, was sagt man dazu?! Aber, wofür wurde der gute Mann aus Bitscha eigentlich geadelt? Etwa dafür, dass er die slowakischen Wälder abholzen ließ? Oder etwa dafür, dass er auf diese Weise Arbeitsplätze geschaffen hat? Na, ich denke: weder – noch. Titel sind auch käuflich, und mit Hilfe dieses „Jahrhundert-Geschäfts“ dürfte der Verleihung der Adelswürde nichts mehr im Wege gestanden haben. Ja, so spielt es sich halt ab im wirklichen Leben: Auf der Gewinnerseite Millionäre und Adelstitel, auf der Verliererseite unzählige verunglückte Bauarbeiter. Diesbezüglich hat sich da seit Ramses Zeiten ganz offensichtlich nicht viel geändert!
Die Idee, den Isthmus zu durchstechen, war ja so neu nicht. Schon im vierzehnten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung machten sich die Herren Sethos I. und auch Ramses II. daran, eine Verbindung der beiden Meere für ihre Kriegsflotten herzustellen. Das gelang wohl auch; allerdings hielt das Bauwerk dem Wüstenwind nicht stand und versandete bald wieder. Im siebten Jahrhundert v. Chr. unternahm Pharao Necho (616 - 600 v. Chr.) erneut den Versuch, vom Nil per Schiff ins Rote Meer zu gelangen. Ein sibyllinischer Orakelspruch aber hinderte den abergläubischen Potentaten daran, den Kanal zu vollenden, der bis zur Einstellung der Arbeiten bereits an die 120.000 Menschenleben verschlungen hatte. Den Kanal zu vollenden, das oblag dann einem der nächstfolgenden Potentaten, einem gewissen Herrn Dareios I. (521 - 486 v. Chr.).
Aber bereits zu Kleopatras Zeiten war der „Durchstich“ wieder teilweise versandet, und die römischen Liebhaber der Dame, Cäsar und Marcus Antonius, interessierten sich nur für sich und – die Dame… Erst die Araber dachten wieder an eine Meeresverbindung, nachdem sie Ägypten erobert hatten. Herr Amr, der Feldherr des Kalifen Omar, ließ im siebten Jahrhundert den Kanal wiederherstellen. Doch schon im achten Jahrhundert war er wieder unbrauchbar. Heute zeugen nur noch schwache Spuren von den Bemühungen der früheren Baumeister…
In der frühen Neuzeit, 1504, richteten dann die Venezianer das Ansinnen an die nun in Ägypten sitzenden Osmanen, sich doch aufs Neue für einen künstlichen Wasserweg zwischen Okzident und Orient zu erwärmen. Begründung: Dom Infante Enriquo lässt grüßen – die Herausforderung durch die lästig gewordene portugiesische Konkurrenz, denn die machte dem venezianischen Dogen seit neuestem den Fernosthandel streitig. Auch Napoleon I., dieser rührige Mann, machte sich 1798 anlässlich seiner „Ägyptischen Expedition“ Gedanken über besagte Meeresverbindung. Jedoch, wie wir ja schon wissen, hat ihm ein gewisser Herr Nelson all seine „Ägyptischen Träume“ verhagelt. Da spielte es schließlich auch keine Rolle mehr, dass ein Landsmann Napoleons, der Ingenieur Lepère, zwischen den beiden Meeren einen Niveauunterschied von 9,908 m errechnet hatte. Fast zehn Meter Höhenunterschied! Wo er die wohl hergenommen hatte, hatten sich seine Vermesser etwa im Sinai verirrt? Na, so abwegig ist das nicht; der alte Moses hatte sich ja in nämlicher Gegend auch schon verstiegen. 1841 schließlich stellten die Engländer mittels barometrischer Messungen fest, dass der Niveauunterschied zwischen den beiden Meeren bedeutungslos ist. Diese Mühe hätten sie sich eigentlich sparen können, wenn, ja wenn nicht schon lange vorher das achte Weltwunder, die Bibliothek von Alexandrien mitsamt ihren 700.000 Bücherrollen, von kriegerischen Analphabeten abgefackelt worden wäre. So musste man also mit den theoretischen Vorarbeiten für das Jahrhundert-Projekt wieder ganz von vorn anfangen.
Читать дальше