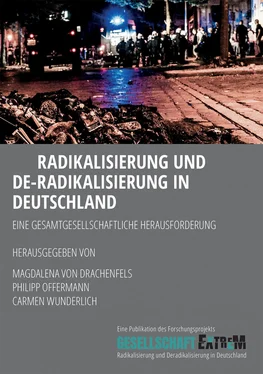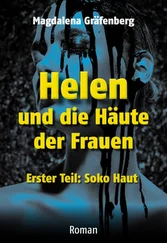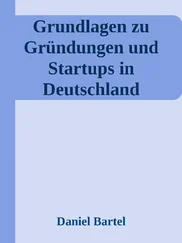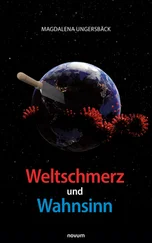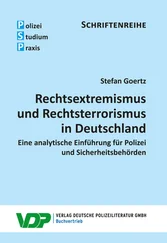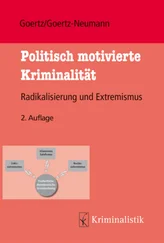Eine solche Begriffsarbeit leisten die drei ersten Beiträge in diesem Band. Schon im ersten Text zeigt Simon Teune auf, wie problematisch eine geteilte Annahme über einen Begriff – hier „Extremismus“ – sein kann. Durch seine Allgegenwärtigkeit schreibe sich die Verwendung des Extremismus-Begriffs immer weiter fort (so auch im Titel unseres Forschungsprojekts), obwohl damit ganz unterschiedliche Dinge benannt werden können. Politisch problematisch, so Teune, werde die Rede vom Extremismus, wenn sie den Raum für Dissenz innerhalb einer Gesellschaft verkleinere. Entsprechend fordert er: „Statt über ein Label vermeintlich Klarheit herzustellen, braucht es eine Auseinandersetzung darüber, was konkret als problematische Entwicklung gefasst wird.“
Über den Anwendungsbereich von Begrifflichkeiten, diesmal allerdings des Radikalisierungsbegriffs, wird auch in den nächsten beiden Beiträgen gestritten. Abay Gaspar, Daase et al. sprechen sich gegen ein rein gewaltgebundenes Verständnis von Radikalisierung und für ein weites Begriffsverständnis aus, das „die zunehmende grundlegende Infragestellung der Legitimation einer normativen Ordnung und/oder die zunehmende Bereitschaft umfasst, die institutionellen Strukturen dieser Ordnung zu bekämpfen“. Zwar stimmt Aziz Dziri zu, dass ein weiter Radikalisierungsbegriff vor allem in der vergleichenden Forschung durchaus angebracht sein könne. Er gibt allerdings auch zu bedenken, dass manche Kontexte, insbesondere solche, die (sicherheitsrelevante Handlungsoptionen nach sich ziehen, einen engen Radikalisierungsbegriff erforderlich machen. „Eine Änderung der Parameter und des Rahmens der Definition“, so seine Schlussfolgerung, sollte daher an die je spezifische Nutzung des Begriffs angepasst werden.
Warum wir nicht vom „Extremismus“ reden sollten
Simon Teune
In der sozialwissenschaftlichen Debatte über Radikalisierung hat es sich – wie im politischen Raum – eingeschliffen, von Extremismus und Extremistinnen bzw. Extremisten zu reden. Doch gerade wenn es darum geht, Prozesse zu verstehen, die in der Befürwortung von Gewalt und schließlich in Gewalthandeln enden, ist die Rede vom Extremismus nicht nur intellektuell unbefriedigend, sondern politisch fatal. Das Extremismuskonzept geht vielen in der Diskussion leicht über die Lippen, weil es unterschiedliche Entwicklungen zusammenfasst, die eine offene Gesellschaft in Frage stellen. Es schafft aber keinen Erkenntnisgewinn – und wirft eine Reihe neuer Probleme auf: die Rede vom Extremismus vernebelt den Blick auf gesellschaftliche Probleme, sie entlässt Akteure aus der Verantwortung, die in diese Probleme verstrickt sind, und sie distanziert diejenigen, die mit Deradikalisierungsprogrammen erreicht werden müssen.
In den Sozialwissenschaften flammt die Diskussion über das Konzept des Extremismus immer wieder auf. Insbesondere in der Forschung zum Neonazismus ist es kritisch diskutiert und in der Konsequenz von vielen in der Substanz abgelehnt worden. Auch wenn einige in Forschung und Zivilgesellschaft den Begriff der extremen Rechte vorziehen, bleibt der Rechtsextremismus bis heute die dominante Bezeichnung. An dem Verlauf dieser Debatte zeigt sich die intellektuelle Trägheit, die den Gebrauch des Extremismuskonzepts insgesamt auszeichnet. Obwohl die Probleme des Begriffs ausgesprochen und anerkannt sind, wird er weiter verwendet und prägt damit den Blick auf die Welt in einer Weise, die auf mehreren Ebenen problematisch ist.
Ein vernebelter Blick auf gesellschaftliche Probleme
Rechtsextremismus, Linksextremismus, islamistischer Extremismus – diese Begriffe schaffen Ordnung im politischen Koordinatensystem. Aber die vermeintliche Klarheit erweist sich bei näherer Betrachtung als Illusion. Gerade der genannte Dreiklang vernebelt den Blick auf sehr unterschiedliche gesellschaftliche Konflikte und Probleme. Auch wenn die Extremismusforschung Unterschiede zwischen den der Logik des Verfassungsschutzes folgenden Phänomenbereichen betont, läuft der Alltagsgebrauch allzu häufig auf eine Gleichsetzung hinaus. Dabei sind nicht alle Begriffe gleichermaßen klar konturiert, so dass deutlich würde, von welchen gesellschaftlichen Akteuren und Problemlagen überhaupt die Rede ist. Allein was unter „Rechtsextremismus“ zu verstehen sei, ist mehr oder weniger konsensfähig: das Zusammentreffen von völkischem Nationalismus, Ideologien der Ungleichwertigkeit und der Bejahung von Gewalt. Welche Problemkonstellation mit dem Begriff „islamistischer Extremismus“ zu fassen ist und noch mehr, wie der Begriff „Linksextremismus“ inhaltlich begründet werden kann, ist kaum befriedigend beantwortet worden. Im letzten Fall ist auf der einen Seite von totalitären Ideologien die Rede, die keine Pluralität zulassen und demokratische Organisationsformen ablehnen. Auf der anderen Seite wird unter „Linksextremismus“ gewaltförmiges Handeln und dessen antikapitalistische und anti-etatistische Legitimation gehandelt. Beides zusammen – eine Haltung der Einschränkung individueller Rechte und die Befürwortung politischer Gewalt – ist aber nur in Bruchteilen bei der radikalen Linken anzutreffen – trotzdem wird das Label deutlich freigiebiger ausgegeben.
Insbesondere dann, wenn es darum gehen soll, Radikalisierungsprozesse zu verstehen, die in Gewalthandeln enden, ist es geradezu absurd, unterschiedliche Formen und Legitimationen der Gewalt gemeinsam zu verhandeln. Dass dies die politische Konsequenz des Extremismusparadigmas ist, zeigt der Versuch, Ausstiegsprogramme auf die radikale Linke zu übertragen – nachgewiesenermaßen ohne Erfolg. Statt über ein Label vermeintlich Klarheit herzustellen, braucht es eine Auseinandersetzung darüber, was konkret als problematische Entwicklung gefasst wird. Nur so werden gesellschaftliche Probleme verhandelbar und für Zivilgesellschaft und staatliche Stellen adressierbar.
Stillstellung gesellschaftlicher Konflikte
Offene Gesellschaften entwickeln sich in der Aushandlung von Konflikten weiter. Solche Konflikte sind nicht aus der Welt zu räumen; sie bleiben in der Regel wegen unterschiedlicher Erfahrungen und Interessen bestehen. Die Formen, in denen solche Auseinandersetzungen verlaufen, sind in großen Teilen eingeübt. Die Akteure beschränken ihre Handlungen dabei in der Regel selbst. Radikalisierung in Gewalthandeln, also die Hinwendung zu einer Form der Auseinandersetzung, die die Selbstbeschränkung aufgibt und die Integrität des Gegenübers in Frage stellt, geschieht insbesondere da, wo die öffentliche Aushandlung gesellschaftlicher Konflikte verweigert wird.
Die Rede vom Extremismus schlägt diese Richtung ein. Sie vermittelt eine binäre und statische Vorstellung von gesellschaftlichen Konflikten: auf der einen Seite die Extremistinnen und Extremisten, die es zu bekämpfen gilt, auf der anderen die Mitte der Gesellschaft und die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die es zu verteidigen gilt. Dass der Streit in Demokratien eine zentrale Qualität ist, geht dabei verloren. Ein Beispiel: Politische Gewalt, vom Steinewerfen bei Demonstrationen bis zum terroristischen Mord, ist tief verwurzelt in männlicher Dominanzkultur. Wenn man diese Perspektive anerkennt, kommt ein Machtverhältnis in den Blick, das die Gesellschaft insgesamt durchzieht. Misogyne Gewalt, männliches Anspruchsdenken, sind Alltag; sich dagegen zur Wehr zu setzen, Gewalt sichtbar zu machen und sie rechtlich zu sanktionieren, ist Gegenstand lang andauernder Auseinandersetzungen. Erst der Kampf um die Ahndung häuslicher Gewalt hat Schutzmechanismen hervorgebracht, die Betroffenen grundlegende Rechte eröffnen. Den Ursprung politischer Gewalt in männlicher Dominanzkultur zu thematisieren, ist deutlich invasiver, als sie in den Handlungsbereich des Extremismus zu verbannen. Es ruft die Verantwortung jeder und jedes Einzelnen auf.
Exkulpation der Mitte
Читать дальше