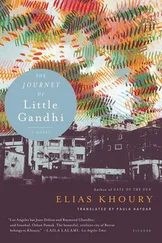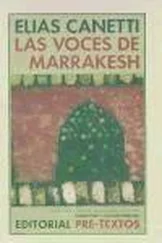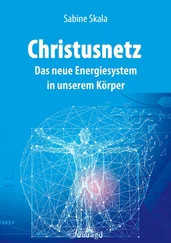Die Bahn hielt am Hauptbahnhof. Schwankend stand ich irgendwie auf, knallte noch ein paar Mal gegen die Sitzlehne und suchte mir dann irgendwie den Weg zur Türe, die mich fast eingeklemmt hätte.
Ich spürte nicht mehr viel. Da war eine Treppe, die von den Gleisen hinunter zum Ausgang führte. Ich lief sie entlang. Unten angekommen merkte ich plötzlich nur noch, dass ich dringend musste. So eine Scheiße, ausgerechnet jetzt.
Ich muss es getan haben. Mir hinter dem Bahnhof, in einer, wie ich glaubte dunklen Ecke, die Hose runtergezogen haben, dahin gekackt haben und dann…
Leute lachten. Sie sahen mich und zeigten mit dem Finger auf mich.
Da lag die alte Wolldecke eines Penners. Während mein Kopf dröhnte, muss ich mir diese genommen haben. Ich stand da mit heruntergelassenen Hosen direkt hinter dem Kölner Hauptbahnhof und hatte diese Decke von dem Obdachlosen in der Hand.
Mir war alles egal. Ich wischte mich damit irgendwie ab und zog mir dann, so gut es ging, meine Hose wieder hoch.
Die Leute sahen mich an und lachten. Ja, jetzt war ich nicht besser als einer von diesen Säufer-Pennern. Ich stank nach Alkohol und wer weiß nach sonst was noch.
Lass’ sie doch lachen, dachte ich mir.
Benebelt lief ich in die nächste Kneipe, die ich hier fand. Wie ich dorthin gekommen war, bekam ich nicht mehr mit. Was dort vielleicht noch geschah, ebenfalls nicht mehr. Ich war so dicht, dass ich nur noch irgendwelche Lichtscheine an meinen Augen vorbei blitzen sah und irgendwelche Stimmen hörte, von denen ich nicht wusste, wo sie herkamen. Alles war egal. Mein ganzes Leben war mir gerade so scheißegal.
Im nächsten Moment sah ich mich wieder zu Hause, durch die Wohnung torkeln.
Wie ich nach Hause zurückgefunden hatte, wusste ich nicht mehr. Ich sah mich nur noch irgendwie neben mir stehen, den Telefonhörer in der Hand haltend.
„Jenny?“, fragte ich dann ins Telefon rein.
Ich war betrunken. Es muss früh am Morgen gewesen sein, und ihr Mann war noch zu Hause, als ich bei ihr angerufen hatte.
„Warum rufst du hier an, Benjamin“; sagte Jenny leise. „Wir haben ausgemacht, dass du diese Nummer nicht wählst.“
„Ich muss dich sehen“, sagte ich zu ihr. „Du fehlst mir. Jenny? Ist Schluss mit uns, oder warum meldest du dich nicht?“
„Jetzt nicht“, sagte Jenny daraufhin.
Und ich hörte ihren Mann irgendetwas sagen.
Aber Jenny machte ihm dann klar, dass es um eine Überraschung für ihn gehen würde, eine Freundin sei am Telefon. Und er solle bitte kurz raus gehen. Das tat er dann offenbar auch.
„Benjamin, du weißt nicht, was ich durchmache“, sagte sie schließlich.
„Was du durchmachst?“, fragte ich. „Weißt du, was ich durchmache? Ich bin scheiße alleine.“
„Bist du betrunken?“, wollte sie dann wissen.
„Ich bin nicht verrückt“, schrie ich plötzlich ins Telefon. „Ich bin nicht verrückt. Alle Welt denkt, ich bin verrückt. Aber ich habe doch gestern nur ein bisschen gefeiert.“
„Was ist los? Du hast doch Alkohol getrunken. Ich höre es doch. Gerade jetzt, Benjamin…“
„Ich habe keinen Führerschein mehr“, lallte ich. „Ich habe gestern in Köln gefeiert.“
„Benjamin… Wenn du es verstehen könntest, würde ich dich ja etwas fragen. Es wäre mir wichtig gewesen, dass du Verantwortung übernehmen kannst. Aber offenbar kannst du das nicht. Vielleicht sollten wir uns trennen. Du bist echt hilflos, und ich kann dir nicht helfen.“
„Jenny… nein… was ist, Jenny? Ich bin nicht verrückt…“
„Benjamin… ich glaube, du bist krank“, sagte sie dann leise.
„Na, und?“, schrie ich sie an, obwohl ich das gar nicht wollte. „Was ist schlimm dran, verrückt zu sein? Vielleicht bin ich verrückt. Krank. Was auch immer. Ist mir egal.“
Jenny sagte nichts.
„Jenny“, weinte ich dann. „Du bist mir nicht egal. Ich liebe dich.“
„Benjamin… ich bin schwanger.“
Stille. Ich sagte keinen Ton.
„Von dir“, warf sie nach. „Ich weiß es seit ein paar Tagen.“
Ich weinte. „Du bist schwanger?“, fragte ich leise. „Wir kriegen ein Kind?“
„Ich habe mit meinem Mann nicht mehr geschlafen, seit ich mit dir zusammen bin“, erklärte sie. „Das weißt du. Er will es nicht mehr, das habe ich dir erzählt. Und er kann es nicht mehr. Schon eine ganze Zeit lang nicht mehr. Es kann nur von dir sein, Benjamin“, schluchzte sie leise.
„Du kriegst ein Kind von mir…“, weinte ich.
„Ich weiß nicht, was ich machen soll“, flüsterte Jenny. „Ich habe überlegt und überlegt… aber ich weiß nicht, wie es weitergehen soll.“
„Ich…“, stammelte ich. Aber ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Ich bekam gerade nichts mehr mit.
„Bitte komm zu mir“, stammelte ich. „Ich will mit dir zusammen sein.“
Jenny legte auf.
Ich heulte endlos. Ich hätte alles haben können. Ganz plötzlich, von der einen auf die andere Sekunde. Eine Familie, eine eigene Familie, in der ich das Oberhaupt war, Jenny meine Frau, und wir hätten ein gemeinsames Kind.
Jenny hatte ja schon mehrmals angedeutet, dass sie darüber nachdachte, ihren Mann zu verlassen und mit mir ein neues Leben zu beginnen. Ich habe eigentlich nie daran geglaubt, dass sie das wirklich durchziehen würde. Viel zu sehr hatte ich mich schon an die Rolle des heimlichen Geliebten gewöhnt, und es war ganz okay für mich.
Und jetzt?
Ich hatte alles verloren. Ja, das glaubte ich fest, und davon war ich überzeugt. Ich hatte alles kaputt gemacht. Keine zwei Monate war ich hier in Solingen, und schon hatte ich alles kaputt gemacht.
Warum nur? Wegen der Trinkerei? War sie mir wichtiger als alles andere sonst?
Es war das erste Mal, dass mir dieser Gedanke durch den Kopf schoss. Jetzt, wo alles verloren war, jetzt, wo es augenscheinlich zu spät war, hörte ich eine Stimme. Und sie sagte: „Du bist ein Säufer.“
Mein Gott… Jenny war schwanger. Von mir.
Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich suchte nach irgendeinem Halt, nach irgendeinem Seil, das plötzlich von der Decke schweben würde und mich retten würde. An dem ich mich festhalten konnte, und es würde mich aus meinem verkorksten Leben rausziehen, und alles würde gut werden, weil am anderen Ende Jenny warten würde. Und dann wären wir zusammen. Endlich.
Aber so war es nicht. So konnte es nicht sein. Dieses Glück würde ich nie haben. Und in diesem Moment habe ich den Glauben, den letzten Glauben daran auch noch verloren.
Ich konnte nicht mehr denken. Ich weinte nur noch. Ich dachte nicht mehr an gestern Abend, an die Kneipe, den Job, den mir irgendeiner anbot, und den ich natürlich auch verkackte. Ich konnte nichts mehr sehen und spüren.
Ich vermisste Jenny so sehr. Aber eigentlich war ich ja schon tot. Alles war tot, weil ich alles verloren hatte. Sie würden mir die Wohnung nehmen und mich zurück nach Bielefeld holen. Sie würden mich zurück in mein altes, kontrolliertes Leben stecken, in dem ich eine Marionette war, ein Spielball, eine Figur, mit der sie machen konnten, was sie wollten.
Ich hatte kein bisschen Selbstvertrauen mehr und wusste, dass es vorbei war.
Noch immer benebelt lag ich auf meinem Bett und starrte nur apathisch an die Decke.
Irgendwann gegen Mittag muss ich erst eingeschlafen sein.
KAPITEL 3: BENJAMINS GESTÄNDNIS
Schon am frühen Morgen – es musste vielleicht so 6 Uhr herum gewesen sein – hörte ich im Halbschlaf, dass es an meiner Türe klingelte. Aber ich war noch zu müde, um aufzustehen. Ich blieb einfach liegen.
„Zeit, bleib’ einfach stehen“, flüsterte ich.
Wenig später hörte ich, wie jemand meine Türe aufschloss und die Wohnung betrat.
Ein Schatten huschte an der Türe meines Schlafzimmers vorbei.
Читать дальше