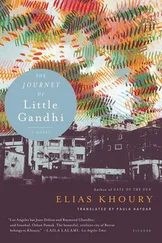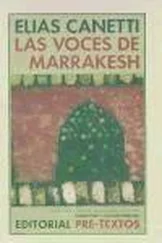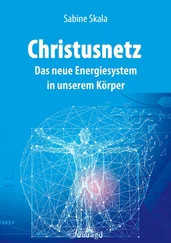Er lachte, während ich mir bereits das zweite Glas Bier reinzog.
„Geschäfte“, sagte ich, ohne näher darauf eingehen zu wollen.
Ich war von Beruf Sohn. Ich hatte nichts gelernt und hatte bestenfalls einen möglichen Job hier in Solingen in Aussicht, für den ich eine Bewerbung geschrieben hatte, damit mir mein Vater die Wohnung kaufen würde.
Aber jetzt war ich jemand Anderes.
„Gut, Geschäftsmann“, meinte der auch schon halbwegs angeheiterte Mann zu mir. „Gibst du eine Runde aus?“
„Ja, sicher“, lachte ich. „Eine Lokalrunde auf mich“, rief ich dem Wirt zu.
Wird ja bei gerade mal acht Leuten sicher nicht so teuer, dachte ich mir. Aber das war mir auch egal. Ich hatte genug Geld bei mir, bestimmt einen Hunderter. Und würde mir am nächsten Morgen Geld fehlen, konnte ich ja Papa anrufen und nach neuem Geld fragen.
Ich hatte wirklich nie gelernt, für mich alleine zu sorgen. Mein Vater kaufte mir die Wohnung unter der Prämisse, dass er sich weiterhin sicher sein konnte, die Kontrolle über mich zu haben. Er war sich ja sowieso davon überzeugt, dass ich nach einigen Wochen wieder in Bielefeld landen würde. Und er ließ mich gehen, aber nur, wenn er mich nicht aus seinem Abhängigkeitsverhältnis verlieren würde. Und damit, dass er mir immer Geld schickte, hatte er dafür gesorgt.
„Spielst du mit, eine Runde Poker?“, fragte dann ein dritter Mann. „Der Verlierer gibt eine Runde.“
Wir spielten den ganzen Abend. Und je voller ich wurde, desto mehr verlor ich. Sieben, acht oder neun Runden hatte ich zu zahlen, verdammter Mist.
Aber was Soll’s, dachte ich mir.
Ich hatte neue Freunde gefunden. Die Leute hier im Lokal waren ganz gut drauf, und je besoffener ich war, desto freundlicher erschienen sie mir.
„Gibst du eine Runde?“
„Komm, bestell noch einen, Kumpel.“
„Du bist Klasse, du kannst ja ganz schön viel in dich rein kippen.“
Ja, das konnte ich. Nach bestimmt zwölf Bier war mein Level noch lange nicht erreicht, und ich wollte weiter trinken. Jedoch machte der Wirt uns darauf aufmerksam, dass er in einigen Minuten die Kneipe für heute schließen würde und forderte uns auf, zu gehen und morgen wieder zu kommen.
„Klar, ich bin dabei“, lallte ich.
Ich hatte ja sowieso nichts zu tun. Der potentielle Job – wer weiß, ob ich den überhaupt kriegen würde – war ja noch weit hin. Deshalb konnte ich hier in meiner neuen Heimat erst einmal rumdümpeln.
„He, ich komme morgen wieder“, rief ich dann in die Runde rein. „Ihr seid klasse, Leute. Wisst ihr was, ich bin auch klasse. Ich bin ein ganz Großer“, warf ich nach.
Die Leute lachten. Ob sie sich für mich freuten, mit mir lachten oder mich einfach auslachten, das war mir egal.
„Ich habe hier in Solingen eine Freundin“, rief ich. „Sie liebt mich.“
„Du bist voll“, stellte der Wirt fest.
„Sie liebt mich wirklich“, sagte ich. „Ich habe einen tollen Job. Ich bin Geschäftsmann. Wie mein Vater. Der ist auch Geschäftsmann. Wir haben viel Geld. Und wo das herkommt, da ist noch mehr.“
„Haha“, meinte einer der Gäste. „Dann kannst du es ja morgen wieder in die Kneipe tragen. Wir freuen uns.“
„Ja“, sagte ich zu ihm. „Was willst du?“, ging ich ihn plötzlich aggressiv an. „Bist du nicht zufrieden, wenn ich Runden schmeiße? Du kannst wohl keine Runden schmeißen.“
„He“, meinte der Mann. „Ich habe auch Runden geschmissen, weißt du?“ Er lachte und sah mich dann ernst an. „Mir gefällt deine Visage nicht“, sagte er schließlich.
„Und jetzt?“, meinte ich mutig. „Was willst du tun?“
„Hier ist man nicht frech.“
„Ich? Frech?“, sagte ich. „He, Mann, du machst mich an? Ich bin frech?“
„Hör mal“, sagte der Wirt schließlich zu mir. „Komm morgen wieder. Für heute hast du genug.“
„Ich habe nicht genug“, brüllte ich. „Ich weiß selbst, wann ich genug habe. Komm schon, mach mir noch ein Bier. Ihr seid doch meine neuen Freunde.“
„Morgen!“, brüllte der Wirt.
„Tolle Freunde“, schnaubte ich.
Dann wankte ich, nachdem ich fast vom Barhocker fiel, zu der Tür, die ich für den Ausgang hielt und prallte dagegen.
Verflixt, dachte ich mir. Aber das war mir egal. Ist mir schließlich schon tausendmal passiert.
Irgendjemand half mir dann durch die Türe, und ich torkelte die Straße hinüber zu dem Hügel, wo der Weg war, der zu meinem Haus führte.
„Aaah…“, rief ich in die nächtliche Kälte heraus. „Solingen, was willst du von mir? Ich bin jetzt hier, du Arschloch. Die kriegen mich nicht mehr. Fick’ dich, Mutter. Schwester. Vater. Fickt euch. Ich bin weg, endlich weg. Ich mache, was ich will. Verdammte Scheiße, ich lebe hier. Solingen… hallo, hörst du mich?“
Wie ich an diesem Abend im Bett – besser gesagt, auf meiner Matratze – gelandet bin, wusste ich nicht mehr. Das Einzige, was ich noch wahrnahm, als ich so da lag, war ab und an das Pfeifen von Joey, meinem Vogel, der in seinem Käfig saß und sich anscheinend über mich kaputtlachte.
Ich wollte mich nicht zurückverwandeln in den schüchternen hilflosen Jungen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte besoffen bleiben. Am Liebsten für immer.
Für Anfang Februar war es heute eigentlich recht mild draußen, so um die 15 Grad. Das war das letzte Mal vor vier oder fünf Jahren so. Ich saß gegen Abend ein bisschen auf dem Balkon und versuchte, abzuschalten.
Jenny hatte sich schon seit zwei Wochen nicht gemeldet, und langsam wurde ich unruhig. Sie sagte ja letztens, dass sie momentan wegen ihrer Arbeit wenig Zeit hätte. Aber sie kam sonst immer alle zwei oder drei Tage her und blieb dann für mehrere Stunden.
Seit zwei Wochen kam sie nicht mehr. Sie rief auch nicht an. Anfangs dachte ich mir nichts dabei, aber nach einigen Tagen geriet ich immer mehr ins Grübeln.
Hatte ich was falsch gemacht? Hatte ich irgendetwas Verkehrtes zu ihr gesagt oder sie verletzt?
Je mehr ich grübelte, desto mehr Vorwürfe machte ich mir. Das war ein ganz typisches Verhalten für mich. Ich hatte es ja nie anders gelernt. Früher, wenn ich irgendetwas verbockt hatte und sogar, wenn ich nicht schuld war, machte man mir nur Vorwürfe.
„Du kannst das nicht.“
„Du bist zu schwach.“
„Du machst alles falsch, du kriegst es nicht auf die Kette.“
Meine Gedanken schweiften ab, in eine Richtung, die ich nicht sehen wollte.
„Was glaubst du, warum du keine Freunde hast“, hörte ich meine Mutter sagen. „Sie mögen einen wie dich nicht. Die einzige Person, die dich je mögen wird, ist deine Mutter. Carina geht irgendwann weg. Du bleibst für immer bei deiner Mutter. Du kannst nicht alleine leben. Du brauchst deine Mutter. Du bist abhängig von mir.“
Ich wusste nicht mehr, wann sie das zum ersten Mal sagte. Früher sagte sie es immer durch die Blumen, aber irgendwann machte sie mir ganz direkt klar, dass ich ohne sie ein Nichts bin. Und das war bis kurz vor meinem Auszug noch so.
Jetzt saß ich hier auf meinem Gartenstuhl und hätte eigentlich froh sein sollen, dass ich die ganze Scheiße in Bielefeld hinter mir gelassen hatte. Aber ausgerechnet jetzt meldete sich Jenny nicht mehr. Und ich fühlte mich wieder ganz alleine. Ich hasste mich selbst dafür, vor allem, weil ich es nicht verstand, dass ich gerade jetzt wieder an diese blöde Familie denken musste, aus der ich kam.
Wäre Jenny jetzt hier, wäre das sicher nicht so.
Plötzlich klingelte das Telefon.
„Jenny?“, fragte ich, als ich abnahm.
„Wer ist Jenny?“, hörte ich die Stimme meiner Schwester Carina am anderen Ende.
„Wieso rufst du an?“, wollte ich wissen.
„Ich habe mich lange nicht gemeldet“, sagte Carina. „Ich weiß. Ich bin eine schwer beschäftigte Frau und habe viel zu tun. Wie geht es dir? Du bist doch bestimmt alleine und langweilst dich.“
Читать дальше