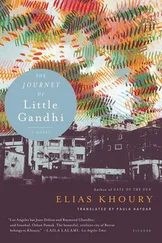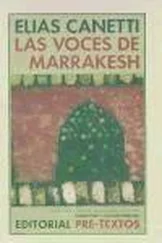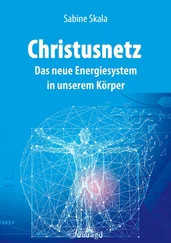Carina hatte Recht. Ich hatte nichts gelernt. Ich könnte nicht einfach auf einen anderen Job umsatteln. Und dass mich jetzt noch jemand für eine Ausbildung nehmen würde, mit 26 Jahren, war eher unwahrscheinlich. So auf die Schnelle würde ich auch nichts mehr finden. Und wenn ich am nächsten Ersten kein neues Geld hätte… Was sollte dann werden? Wie sollte ich dann für Jenny und Mathilda sorgen?
Ich saß zitternd in der Wohnung und wusste nicht, was ich machen sollte. Ich grübelte, und meine Gedanken wurden immer wirrer.
Es war nicht das erste Mal, dass ich wirre Gedanken hatte. Aber so deutlich, so intensiv wie jetzt, hatte ich sie noch nie bemerkt. Plötzlich wurden Dinge real, die sonst nicht existieren. Personen, die ich selten oder gar nicht sah, waren auf einmal hier und machten mir das Leben zur Hölle, oder sie versuchten gleich, es zu beenden, indem sie mir so zusetzten, dass ich starb.
Mein Vater war tot. In meiner irrationalen Phantasie ist er gestorben. Jetzt gab es nur noch meine drangsalierende Schwester und meine Mutter. Beide wollte ich nicht sehen, beide hätte ich am liebsten für immer aus meinem Leben gestrichen.
Die Tür von meiner Wohnung ging auf. Schwester und Mutter kamen herein.
„Papa ist tot“, sagte Carina.
„Ich habe hier ein Leben“, entgegnete ich.
„Du hast kein Geld mehr“, sagte meine Mutter. „Du kannst nicht weiter studieren, wir können es nicht mehr bezahlen. Und Carina ist eine viel beschäftigte Geschäftsfrau. Du musst nach Hause kommen. Ich kümmere mich um dich.“
„Wie du dich um mich kümmerst, das kenne ich“, widersprach ich. „Und ich will es nicht. Nie mehr.“
„Du hast kein Recht auf eine eigene Meinung“, sagte Carina. „Du bist schwach, klein und abhängig von Mutter. Du brauchst sie.“
„Komm mit, das Auto steht unten“, sagte die Mutter. „Carina fährt uns nach Hause.“
Ich wusste nicht, ob sie mich fesselten, oder ob ich freiwillig mitgegangen bin. Freiwillig sicher nicht, aber ich konnte mich nicht wehren. Ich konnte mich ihnen einfach nicht widersetzen.
Ich habe mich Mutter nie widersetzen können. Wenn einem Kind so etwas angetan wird, sagen sie dem Kind ja immer, es soll reden. Es soll erzählen, was war, damit es das Geschehene verarbeiten kann.
Mir hat noch nie jemand etwas gesagt. Es wusste auch keiner. Ich hatte noch nie mit jemandem darüber reden können. Und schon gar nicht hätte ich mich getraut, meine Schwester oder meine Mutter selbst damit zu konfrontieren, dass ich es nicht vergessen hatte. Und vor allem, dass es mir noch immer höllisch weh tat, obgleich es Jahre her war.
Wir fuhren nach Bielefeld in mein früheres Elternhaus. Mein Zimmer – Mutter nannte es noch heute Kinderzimmer – war unverändert. Sogar die Spielsachen, die ich als Kind hatte, waren noch da. Ich hatte eine Rennbahn, eine Eisenbahn und ein Puppenhaus. Mutter hatte mich als Kind oft als Mädchen gesehen, deswegen kaufte sie mir irgendwann dieses Puppenhaus. Manchmal zwang sie mich, damit zu spielen und sah mir dabei zu.
Carina ging dann wieder in ihre eigene Wohnung, in ihr eigenes Erwachsenenleben, und sie ließ mich mit Mutter zurück. Und während ich in meinem Zimmer saß, kam Mutter rein.
„Willst du mit deinen Puppen spielen, Mädchen?“, fragte sie. „Papa wäre stolz auf dich. Er würde sagen, das macht sie sehr gut.“
„Ich bin ein Junge“, entgegnete ich ihr. „Ich bin ein Mann. Ich bin fast 27 Jahre alt.“
„Du wirst immer mein kleiner Junge sein“, erwiderte meine Mutter. „Oder mein Mädchen, so wie du es als kleines Kind immer wolltest.“
„Ich wollte nie ein Mädchen sein.“
„Du wolltest, dass ich dir Mädchennamen gebe“, erläuterte sie. „Jede Woche hast du dir einen anderen Namen ausgesucht. Wie willst du heute heißen, Mädchen?“
„Mutter, du bist krank“, antwortete ich.
„Du bist krank, mein Junge“, stellte sie klar. „Aber mach’ dir keine Sorgen. Ich werde mich um dich kümmern. Du musst nicht raus gehen, wo dich alle sehen. Du kannst hier bei deiner Mutter bleiben.“
Ich glaube, sie legte mir dann Ketten oder so was an. Auf jeden Fall war ich in der nächsten Minute ans Bett gefesselt. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich versuchte, mich zu befreien, aber es gelang mir nicht.
„Mutter ist bei dir“, hörte ich diese Frau immer sagen.
Und auf einmal war ich kein Mann mehr. Ich war tatsächlich ein kleiner Junge, hilflos, ausgeliefert und wehrlos. Vielleicht neun oder zehn Jahre alt. Ich lag da, gefesselt auf dem Bett, und dann wurde es mir schwarz vor Augen.
Das nächste, was ich sah, war eine dunkle Straße, durch die ich lief.
Wo zum Henker war ich? Kannte ich diese Straße? Sie kam mir bekannt vor, obwohl ich gleichzeitig das Gefühl hatte, noch nie hier gewesen zu sein. Es war alles so real und gleichzeitig so surreal.
Ich lief einen Hügel hinunter. Dann kam ich an einen Bahnhof. Ich erkannte ihn wieder.
Solingen. Hier war ich zu Hause. Dieser Bahnhof, dieses alte Haus mit der Neonaufschrift, die in großen Lettern das Wort „Boxer“ zeigte. Meine Stammkneipe.
Ich ging rein.
Mit jedem Bier, das ich trank, verschwanden die negativen Gedanken ein Stückchen mehr. Und mit jedem Schluck fühlte ich mich ein besser. Apathisch saß ich in der Ecke und trank.
Als Rainer reinkam, sah er mich und setzte sich zu mir.
„Meine Güte, was ist denn mit dir los, Benjamin?“, fragte er.
„Ich…“, stammelte ich. „Mein Vater ist krank. Meine Schwester sagt, ich soll nach Bielefeld zurückgehen.“
„Aber du studierst doch hier“, meinte Rainer.
„Ich werde nicht weiter studieren können“, antwortete ich. „Mein Studienplatz wird mir genommen werden, weil ich ihn mir nicht mehr leisten kann.“
„Nur die Ruhe“, versuchte er mich zu beruhigen. „Ich weiß, was in so einem Fall zu tun ist. Wenn du kein Bafög bekommst, dann musst du dich zwar exmatrikulieren, aber du kannst zum Amt gehen. Die geben dir Geld, solange du noch keinen Job hast.“
„Und die Wohnung?“ Fast weinte ich. „Ich werde sie auch verlieren. Ich kann mir die Nebenkosten nicht leisten.“
„Sie werden dir eine kleinere Wohnung geben“, erklärte Rainer. „Und wenn du das erreicht hast, dann bist du unabhängig von deiner Familie. Lass nicht zu, dass deine Schwester und deine Mutter dich bevormunden.“
Rainer war von Allen, die hier in der Kneipe saßen, noch der Vernünftigste.
Aber ich hatte eine Wahnsinnsangst. Ich wusste nicht, was werden sollte. Ich trank den ganzen Abend, um meine Angst zu vergessen. Ich trank, um den Schmerz zu vergessen, an den ich mich in letzter Zeit immer wieder erinnern musste. Ich trank, um alles zu vergessen. Ich wollte nicht mehr, nur noch trinken.
Am nächsten Mittag – ich hatte keine Ahnung, wie ich nach Hause gekommen war, oder was in der Nacht sonst noch passiert ist, geschweige denn, wo ich überall noch war – wachte ich auf dem Sofa auf. Der Fernseher war an, und mein Portmonee lag auf dem Tisch.
Mein Portmonee. Da hatte ich gestern die letzten 600 Euro drin, die auf unbestimmte Zeit reichen sollten. Ich hatte ja keine Ahnung, wann ich das nächste Mal an Geld kommen sollte.
Vorsichtig nahm ich es und sah nach…
Alles war weg. Alles bis auf drei oder vier Euro, die noch im Schubfach für Kleingeld waren.
Nein… ich hatte gestern mein ganzes Monatsgeld ausgegeben. Ich hatte nichts zu essen, ich hatte kein Geld mehr für die nächsten Wochen und kein Geld mehr, bis ich neues kriegen würde. Ich hatte niemanden, den ich fragen konnte, niemanden, den ich um Rat bitten konnte.
Jetzt wusste ich es. Jetzt war es mir klar. Es war mir schon viel länger klar, aber ich wollte es nie wahrhaben. Ich hatte immer nach einem Grund gesucht zu trinken. Ich hatte immer versucht, Ausreden dafür zu finden, warum ich trinken musste, statt mich meinen Problemen zu stellen. Nie habe ich mich ihnen gestellt, bin immer davongelaufen und habe getrunken. Und ich habe nicht bloß getrunken, ich habe hemmungslos gesoffen. Immer wieder, fast jeden Tag.
Читать дальше