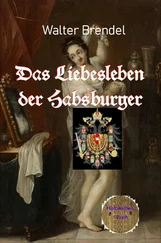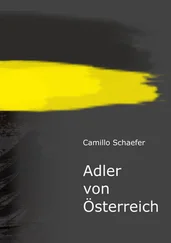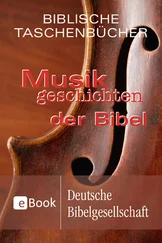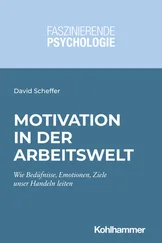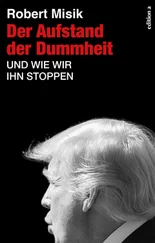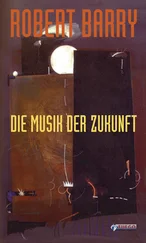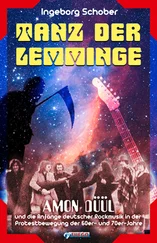Unter den vielen ausländischen Gästen blieben die italienischen Fürstenhäuser allerdings in der Minderzahl - Albrecht V. hatte sie nur deshalb eingeschränkt eingeladen, da er die Vergleiche solcher Adelsträger von "großer herrlichkeit vnnd pracht" mit seiner Hofhaltung scheute und aller eigenen Renaissanceherrlichkeit zum Trotz deren kulturelle Überlegenheit befürchtete.
Vermutlich hatte Orlando di Lasso anlässlich dieser Hochzeitsfeier, die - als prunkvolles Fest gesehen - ebenfalls eine Art bedeutungsvolles Repräsentationstheater war (6), eine eigene Messe komponiert; neben einer Reihe weiterer Musiker wurde nach der Summe des in den höfischen Zahlbüchern ausgewiesenen Geldgeschenks aber nur noch der Italiener Annibale Padovano ebenso hoch eingeschätzt und bezahlt.
Um 1527 geboren, war Padovano zuerst Organist in San Marco gewesen, bis er 1566 als Komponist, Organist und Lautenist zur Grazer Hofkapelle übersiedelte, die als Erbe Ferdinands I. galt. Padovano verdrängte dort schon nach vier Jahren den niederländischen Komponisten Johann de Cleve (1529-1582) - womit faktisch eine musikhistorische Epoche beginnt, die in Hinkunft völlig von den Italienern beherrscht werden sollte (7), deren Reservoir an musikalisch-künstlerischen Kräften wahrhaft ungeheuerlich anmutet. Als Padovano 1575 in Graz verstarb, wurde sein Nachfolger als Kapellmeister der italienische Posaunist und Komödiendichter Simon Gatto (1535-1591), der schon seit 1568 in München wirkte und bereits den mehrchörigen, akkordischen Prunkstil einsetzte; seine Messe >Hodie Christus natus est< enthält im letzten Agnus Dei vier Hexameter, die sich eindeutig auf die vorgenannte Hochzeit von 1571 beziehen: "Vive Maria, diu, Boiorum gloria stirpis-Carolus Austriace vivat, dux inclytus ore."
Bei der Wiederherstellung der Grazer Hofkapelle (1596), die sich gleichzeitig mit der Erbhuldigung Ferdinands II. in Graz vollzog, waren die Italiener demgemäß bereits in der Überzahl. Die nunmehr bereits fix besoldete Kapelle bestand aus 18 Sängern, 3 Organisten sowie 24 Instrumentalisten und galt fortan als kaiserliche Hofmusik, an deren Spitze Philipp de Monte aus Mecheln (1521-1603) stand, der 500 Gulden jährlich bezog. Unter Ferdinand III. war die Hofkapelle bereits auf 27 Sänger, 4 Organisten, 21 Instrumentalisten, 10 Trompeter, einen Pauker, 2 Notenschreiber und Kalkanten, einen Instrumentendiener sowie einen Instrumentenbauer angewachsen. Kaiser Rudolf II. (1552-1612), der auf dem Prager Hradschin residierte, öffnete dessen Pforten nicht nur wunderlichen, angeblich Gold fabrizierenden Alchemisten und mystischen Sterndeutern, denen die Vorliebe des geheimnisvollen Regenten galt, sondern besaß zudem - obschon seine Zeit kaum epochale Komponisten, wohl aber die epochemachende Ausübung der frühen Oper aufbot - eine Hofkapelle von immerhin 87 Mann, deren Spitze gleich vier Hofkapellmeister angehörten, deren ältester, Jakob Regnard (1531-1599) bereits aus den Diensten Maximilians II. kam und nach dessen Tod von Rudolf II. nach Prag berufen wurde. Von Regnard hat sich eine größere Anzahl an Messen, Motetten, Kanzonen und deutschen Liedern nach italienischem Vorbild erhalten. Hans Leo Hassler aus Nürnberg, vorher Organist beim Grafen Fugger, blieb von 1601 bis 1608 in der gleichen Eigenschaft (und, wie er sich selbst spöttelnd bezeichnete) als "kaiserlicher Hofdiener" in Prag. Ebenso kam Jacobus Gallus (eigentlich Jakob Handl, 1550-1591) den man als den >deutschen Palestrina< bezeichnete, ein hochrangiger Musiker der deutschen Schule, auf die Prager Burg. Ihm setzte Henrikus Goetling 1593 den Nekrolog: "... Wem soll nun seine Musik gut / Erweichen nit beid Hertz und Muth / Er müst fürwahr ganz steinern sein". Dazu gesellten sich 1600 noch Alessandro Orologio, ebenfalls ein Virtuose von großem Ruf, sowie Tiburzio Massaino aus Cremona, ein Augustinermönch und „äußerst fruchtbarer Kirchenkomponist“ hinzu.
Neben den beiden Organisten Karl Leyton und Alessandro Milleville ragt besonders Francesco Turini, ein hochgelehrter Kontrapunktist und Kanonist hervor, den Kaiser Rudolf zuvor nach Rom und Venedig zu Studien schickte; an seiner Seite wirkt aber auch der Vater, Gregorio Turini, ein kunstvoller Sänger und Zinkenbläser aus Brescia (8) mit. In Zukunft blieb die Vorherrschaft in der Musik damit durchwegs italienischen Kräften vorbehalten, die vor allem bald nach Wien drängten, wo sie unter den Habsburgerkaisern bald eine dominierende Stellung erreichten, die bis weit ins 18. Jahrhundert hinein anhielt. Sogar noch die Symphonien des kaiserlichen Hofkompositeurs und Domkapellmeisters Johann Georg Reutter, der Haydn als achtjährigen Chorsänger ins Kapellhaus von Sankt Stephan holte, waren gänzlich dem >Servizio di Tavola< bestimmt (9).
Die Frage, ob Musikalität erblich ist oder nicht, hat bekanntlich immer wieder zu grundverschiedenen Antworten geführt. Ein klassisches Beispiel ihrer Bejahung bleibt das Musikergeschlecht der >Bache< mit der Zentralfigur Johann Sebastian Bachs (1685-1750), dessen erbmäßige musikalische Anlagen sich innerhalb seiner Familie bis um 1550 zurückverfolgen lassen und dessen überragende Bedeutung gleichwohl alle seine Vorfahren wie Nachkommen überstrahlt. An der Kompositionstechnik Carl Philipp Emanuels (1714-1788), des so genannten Hamburger oder Berliner Bachs, orientieren sich zwar noch Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven, die wie Mozart, der sich am Beispiel des Mailänder oder Londoner Johann Christian Bach (1735-1782) bildet, sozusagen deren Erbe als musikalische Meistergeneration zur viel zitierten Wiener Klassik empor führen werden, doch das Talent von Bachs Lieblingssohn Wilhelm Friedemann (1710-1784) trägt, trotz seines gefühlvollen Stils, nicht mehr die vom Vater erhofften Früchte.
Schon W.A. Mozarts Vater, Leopold (1719-1787), besitzt als Violinist, Komponist und Musikpädagoge einen hervorragenden Namen, Beethoven wird als zweiten Sohn eines Bonner Hoftenoristen ebenso die Musikalität gewissermaßen schon in die Wiege gelegt; Brahms ist seinerseits der Sohn eines Kontrabassisten, die Dynastie der wienerischen Walzerkönige Strauß lässt erbliche Zusammenhänge überdeutlich erkennen. In ebensolchem erblichen Zusammenhang stehen die Namen Alessandro Scarlatti - von dem noch berichtet wird - und dessen Sohn Domenico (1685-1757), genannt Mimo, aber auch die große Komponistenfamilie um Jean Baptiste Lully, der als Sohn eines italienischen Müllers zum Schöpfer der französischen Nationaloper aufsteigt, sowie die Namen der beiden Brüder Joseph und Michael Haydn.
Auf die komponierenden Habsburger selbst trifft wohl der Regelfall zu, dass das musikalische Talent innerhalb eines Familienstammbaums in einer Einzelperson kulminiert, die neben Ferdinand III. doch zweifelsfrei Leopold I. zu sein scheint, obgleich auch dessen noch in der Jugendzeit verstorbenem Sohn Josef I. durchaus eine größere Musikbegabung zugeschrieben wird. Freilich bleibt sie nicht verifizierbar, und weder Leopolds Vorfahren noch seine Nachkommen besitzen auch nur annähernd seine musikalische Kapazität.
Die Lust am Musikalischen vererbte sich zwar von Maximilian dem letzten Ritter über Karl V. bis weit zu Karl VI. und dessen Nachfolgern hinaus, äußert sich aber in all diesen Nachfahren bloß als reproduktive Ausübung, die späterhin völlig erlischt. Karl V., sowohl in den Niederlanden wie in Madrid residierend, unterhielt gleich zwei Hofkapellen, die mit jener des Erzherzogs Ferdinand und späteren Kaisers in Wien konkurrierten, so dass zeitweilig faktisch drei (!) Hofmusikkapellen indirekt nebeneinander bestanden, worin beispielsweise so berühmte Komponisten wie Francesco Guerrero aus Sevilla (1528-1599) oder Mattheo Flecchia, welcher eine eigene Theorie des Kontrapunkts verfasste, neben 44 weiteren Musikern wirkten, die als >Zierde des Madrider Hofs< galten.
Читать дальше