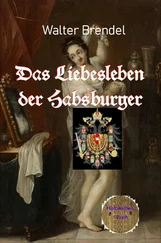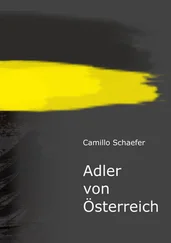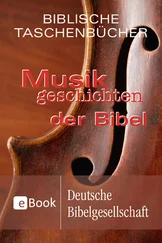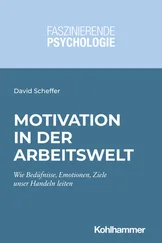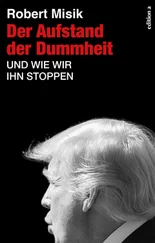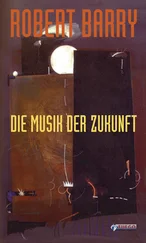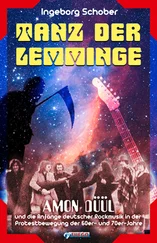Dienten Kantorei und Kapelle dem Kaiser zunächst noch vorwiegend zum Lob Gottes sowie der christlichen Kirche (2), war der vorerwähnte, berühmte Paul Hofhaimer (1426-1497), als Maximilian gemeinsam mit dem Land Tirol 1490 die Innsbrucker Hofkapelle aus der Hand Erzherzog Sigismunds (1426-1497) übernahm, schon sein erster Hoforganist. Noch mitten in der Renaissancezeit gründete Maximilian daraufhin 1498 in Wien mit seiner Hofkapelle, welcher der slowenische Humanist und spätere Fürstbischof Wiens, Georg von Slatkonia (1456-1522) vorstand, das erste weltliche Musikorchester von europäischem Rang, zugleich "eine der kostbarsten und lebendigsten Gaben des Humanismus" (c Witeschnik). - Damit schlug sozusagen bereits die Geburtsstunde der späteren Wiener Opernkunst, die sich später aus einem runden Dutzend Sängerknaben und einigen Musikern, die zunächst nur in der Burgkapelle musizierten, fortentwickelte. Die allerbesten Tonsetzer jener Zeit wirken daran mit - so der geniale Komponist Josquin des Prés (1436-1521), einer der ausgezeichneten Meister der niederländischen Schule, der in seinen Messen und Motetten zu vier und fünf Stimmen, Kanons, Psalmen usw. die Fertigkeit des Kontrapunkts zu einem ästhetischen Höhepunkt führt, und auch erst als Kapellmeister Maximilians I. stirbt; der Satzkünstler und Meister der Vokalpolyphonie Pierre de la Rue (1460-1518); Paul Hofhaimer als >Organistenmaister<, wie Maximilian ihn persönlich im Entwurf zu seinem Triumphzug nennt; der als >Lautenschlagermaister< bezeichnete Artusi (1540-1613); Heinrich Finck (1445-1527); Hans Judenkunig (ca. 1450-1526) sowie Erasmus Lapicida (†1547), die alle in kaiserlichen Diensten stehen. Der Flame Heinrich Isaac (1450-1517), bereits ein gewaltiger Kontrapunktiker, wird zum ersten Hofkomponisten und bekleidet damit die begehrte Musikmeisterstelle (symphonista regius). Später, als er Gesandter in Venedig wird, rückt sein Schüler, der >liederreiche< Ludwig Senfl (1485-1555), ein gebürtiger Niederländer, dessen Kunst Martin Luther vielfach belobte, zu seinem Nachfolger auf. Ähnlich wesentlich erweist sich das Auftreten des Kirchenkomponisten Johann Stadlmayer (1560-1648), der die Verbindung zum volkstümlichen Lied herzustellen sucht, denn von nun an beginnt die bisher vorwiegend dem kirchlichen Dienst verpflichtete Musik ihren Sprung auf die Bühne, indem sie sich mit der Wortkunst verbindet (3). Konrad Celtis (1459-1508), der erste deutsche Dichter, der über Protektion des Kurfürsten Friedrich von Sachsen schon durch Kaiser Friedrich III. zum >Poeta laureatus< gekrönt und mit dem Doktorhut ausgezeichnet wurde, gibt bereits regelmäßige Vorstellungen in der Wiener Hochschulaula.
Anfangs noch klotzige antike Dramen, nähern sie sich in Umrissen rasch der Wiener Musikkomödie, der die Zukunft gehört. Die >Lizenza< (Verbeugung vor dem regierenden Haus), die volkstümlich-derbe Komik, Musik, Tanz, Chor sowie Einzelgesang sind bereits die kompletten Ingredienzien der späteren Wiener Barockoper. Die Leichtblütigkeit der Stadt macht sich besonders in den volkstümlichen Liedeinlagen bemerkbar: Celtis' >Rhapsodia, laudes et victoria Maximiliani de Boemannis< (1504), von einer Studentengruppe vor dem Kaiser gegeben, kann mithin schon als die erste kunstvolle Vorwegnahme der späteren Musikdramen angesehen werden.
Unter Kaiser Karl V. (1500-1558) wetteifern mit der Wiener Kapelle die Hofkapellen in Madrid und Brüssel, und schon als König von Ungarn und Böhmen holt Kaiser Ferdinand I. (1503-1564) einen der vortrefflichsten Kontrapunktisten seiner Zeit, den niederländischen Komponisten Arnold von Bruck (ca. 1500-1554), an seinen Hof, wo er die von Maximilian I. gegründete Hofkapelle auf 50 Mitglieder erweitert. Am Augsburger Reichstag (1548) erregt somit nicht nur die musikalische Leistung seiner Hofkapelle allergrößtes Aufsehen, sondern auch die enorme Summe von 20. 000 Gulden, die ihm dieses musikalische Vergnügen persönlich kostet.
Dem Sohn Karls V., König Philipp II. von Spanien (1527-1598), der unter anderem ein leidenschaftlicher Sammler von Musikinstrumenten ist, gefällt speziell die flandrische Musik so vortrefflich, dass er diese nach einer Habsburger-Zusammenkunft im Winter 1550/51, anlässlich der er auch seine deutschen Verwandten kennenlernt, sogar bei sich im Lande einführt.
Im Jahrhundert zwischen dem Beginn der Reformation und dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges bewirkt die Strahlkraft der Renaissance einen ungeheuren Aufschwung der Musik, der ihresgleichen erst in späteren Zeiten wieder findet. Eine nochmalige Steigerung erfolgt durch die hitzige Ausbreitung des Notendrucks. Nach venezianischem Vorbild entsteht 1512 das erste gedruckte deutsche Liederbuch. Die Fürsten sind ständig bestrebt, in ihren Hofkapellen die besten Sänger und Instrumentalisten zu vereinen, um sich möglichst gegenseitig zu übertrumpfen. Kaiser Maximilian II. (1527-1576) zieht mit seiner Kapelle, die er bereits auf 83 Mitglieder aufgestockt hat, 1566 zum Augsburger Reichstag - 1575 begegnen seine Hofmusiker und Sänger der berühmten Hofkapelle des Herzogs Albrecht von Bayern beim selben Anlass in Regensburg. Das repräsentativste Musiksammelwerk des 16. Jahrhunderts >Thesaurus musicus< (1568), das Maximilian II. und seinen Brüdern gewidmet ist, weist aus, dass nahezu alle der insgesamt 250 darin enthaltenen Motetten von Musikern stammen, die sich um diese Zeit in habsburgischen Diensten befinden. Kaiser Matthias (1557-1619) bringt 1612 seine Kantorei zur Frankfurter Krönung mit; die Musikerfamilie um Lambert de Sayve (ca. 1549-1614) ist darin führend, der einheimische Christoph Strauß (ca. 1575-1631), ein Kammerorganist, hält die Hofkapellmeisterstelle.
Im Jahr 1618 lässt Kaiser Matthias trotz der düsteren „äußeren politischen Verhältnisse im Rahmen der so genannten >Wirthschaften<, die das kaiserliche Paar für seine Gäste nach dem Vorbild rustikaler ländlicher Feste veranstaltet, große Wagen mit ganzen Bühnen auf den inneren Burghof bringen, auf denen Venus und die neun Musen, der Olymp und der Parnass dargestellt sind - ein opulentes Spektakel, das mit seinen Huldigungschören sowie einem Diskantisten, der die höchste Tonlage hält, geradewegs der barocken Opernidee entnommen sein könnte.
Die Münchener Hofkapelle, die schon 1526 nach dem Vorbild Kaiser Maximilians I. von Ludwig Senfl umgestaltet wird, erlebt ihre Glanzzeit ab 1556 mit der Berufung des >Belgischen Orpheus< Orlando di Lasso (1532-1594), der sich am Münchener Hof die Stellung eines so genannten >princeps musicae< erwarb. Seine beherrschende Persönlichkeit geht in ihrem Wirken über Bayern, wo er die spezifische Renaissancekultur entscheidend mitprägte aber weit hinaus; neben seiner Verbindung mit dem französischen Hof steht er auch in Beziehung zum kunstsinnigen Ferdinand I. in Innsbruck und wirkt um die Herausarbeitung der musikalischen Form >Oper< mit solch unschätzbaren Verdiensten, dass man ihn als kulturelle Zentralgestalt seiner Epoche schlechthin ansehen darf (4). Bei den Hochzeitssolennitäten für Erzherzog Karl II. von Innerösterreich mit Maria von Bayern (1571) in Wien und Graz, wo sich die beinahe programmatische Habsburger-Formel "Bella gerant alii, tu felix Austria nube" einmal mehr erfüllt, ist Orlando di Lasso ebenfalls mit dabei. Die prunkvolle Ausstattung besorgt der Brautvater, Albrecht V. (1528-1579), dessen Neigung zu großartigen Festlichkeiten allgemein bekannt war - gleichsam im Nebeneffekt, zielte die enorme Prachtentfaltung darauf ab, die religiös gespaltenen Erbländer mit entsprechendem Pomp zu beeindrucken. Während der Wiener Trauungszeremonie wird ein festliches >Te Deum< gegeben, an der feierlichen Tafel selbst spielt man >diversi concerti<. Auch der große Ball danach war selbstverständlich von einer Reihe musikalischer Darbietungen umrahmt, so dass man sicherlich nicht fehlgeht, sich die hochzeitlichen Musikaufführungen vom prunkvollen mehrchörigen Kirchenstil und die noch madrigaleske Tafelmusik bis zum Ballett und zur Comedia dell'arte hin vorstellen zu dürfen. Daneben trat, nach überaus intensiven Vorbereitungen, die auch eine große Anzahl von Handwerkern beschäftigten, welche Luxusgüter und Ziergegenstände, Schmuck und kostbare Harnische herzustellen hatten gewissermaßen als früher Vorbote dieser Literaturgattung das wohl allererste, uns bekannte Jesuitendrama auf den Plan. Nach dem biblischen Stoff von Samson und Delilah wurde darin die unbedingte Heiligkeit der Ehe ebenso angesprochen wie die "Unzulässigkeit einer Verbindung mit Andersgläubigen, also konkret mit den Protestanten" (5).
Читать дальше