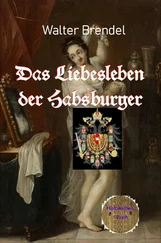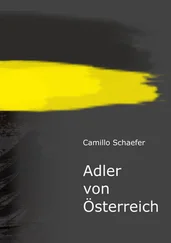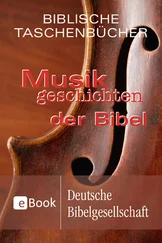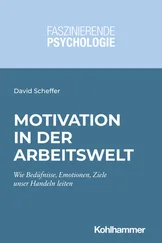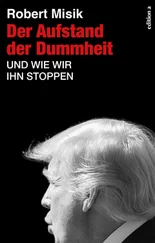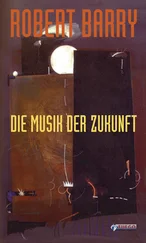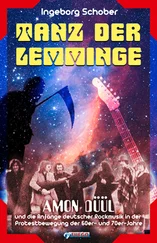Selbstverständlich haben einander so entgegen gesetzte Musikepochen wie etwa Kirchen- und Oratorienstil, die Repräsentationsoper des Barock, die italienische Belcanto- und Koloraturinflation, der pathetisch angelegte Stil Glucks oder die stets lebendig gebliebene Mozart-Oper zwangsläufig zu vollkommen verschiedenen Grundlagen hinsichtlich der jeweiligen Geschmackserziehung geführt - nichtsdestoweniger erfolgt schon 1812 in Wien die Gründung der >Gesellschaft der Musikfreunde des österreichischen Kaiserstaates<. Von 1831 bis 1835 steht ihr Erzherzog Anton Viktor (1779-1835), der achte Sohn Kaiser Leopolds II. vor - und tatsächlich erwirbt man sich damit nachhaltige Verdienste um das gesamte Konzertwesen schlechthin. Im neuen Haus, dem 1864 erbauten, prachtvollen Musikvereinsgebäude, entstand sowohl die große Bibliothek, die nur noch von den Schätzen der Nationalbibliothek übertroffen wird, und auch die umfangreiche Sammlung zur Geschichte der Musik. Erzherzog Eugen (1863-1954), der Protektor dieser Gesellschaft, stand ab 1906 auch der Stiftung >Mozarteum< in Salzburg sowie des Musikvereines in Innsbruck vor.
Noch in den Vormärz hinein fällt die Gründung der philharmonischen Konzerte, aus denen das Orchester der Wiener Philharmoniker hervorgeht, während der >Wiener Männergesangverein< (1843), der >Akademische Gesangverein< und der >Schubertbund< seither die Gesangskunst pflegen. Zur selben Zeit findet die Oper ihre Heimstätte im >Kärntnertortheater<, das ab 1853 als >k. k. Hofoperntheater< geführt wird. Hier spielte man vor allem Carl Maria von Weber, Konradin Kreutzer, Giacomo Meyerbeer, Albert Lortzing, Franz von Suppé und Friedrich von Flotow, aber auch italienische Opern sowie Kirchen- und Hausmusik, so dass sich auch in dem auf den Vormärz folgenden Jahrzehnt des Neoabsolutismus ein höchstvielfältiges Musikleben entfalten konnte. 1869 wird das neue Hofoperntheater mit Mozarts >Don Giovanni< eröffnet, das alte Haus erst 1870 mit Rossinis >Wilhelm Tell< geschlossen.
Nach der Entscheidung zugunsten des dualistischen Prinzips sowie einer >kaiserlich-königlichen< (k. u. k.) Doppelmonarchie war die Krönung zum König und zur Königin von Ungarn (1867) Kaiser Franz Joseph I. und seiner Gattin Elisabeth zur politischen Pflicht geworden. Der Virtuose Franz Liszt komponierte für das Zeremoniell mit der anschließenden Salbung des Herrscherpaares in der Matthiaskirche in Budapest seine bekannte >Krönungsmesse<, die im Rahmen des feierlichen Hochamtes dort uraufgeführt wurde. Bei der Leichenfeier für Kaiser Ferdinand I. (1793-1875) in der Kapuzinerkirche in Wien, zeigte dessen Nachfolger, Franz Joseph I., gerade so viel an Musikverständnis, dass der Vizehofkapellmeister Gottfried v. Preyer nach einigen Takten, vom höchst erregten Monarchen schon mit tadelnden Blicken bedacht, das traditionelle >Libera< abklopfen musste, dessen Grundakkord er als Dirigent derart undeutlich gesummt hatte, dass die Hofsängerknaben, Bassisten und Tenöre darauf falsch eingesetzt hatten (16).
Schon seit dem Vormärz hatten die zeitgenössischen italienischen, französischen und deutschen Importopern einerseits zur Stagnation einheimischer Opernkomponisten und um die Jahrhundertmitte zum Rückgriff auf die Werke Mozarts und Glucks geführt. Richard Wagner hielt sich zwar zur Durchsetzung seiner Opern ein einziges Mal in Wien auf, wollte aber der Intrigen wegen, denen er sich hier ausgesetzt fühlte, nicht wiederkommen. Den österreichischen Komponisten selbst gelang es in jener Zeit jedoch kaum, Modernes zu schaffen. Erst am Beginn des 20. Jahrhunderts wird dieser Anspruch verwirklicht. Julius Bittner erweist sich als der am stärksten von Wagner geprägte Komponist, Alexander v. Zemlinsky, Lehrer und späterer Schwager von Arnold Schönberg, als Eigenständigster, Franz Schreker als ebenso wandelbar wie Ernst Krenek oder Erich Wolfgang Korngold (17).
Gleichzeitig war Wien in vormärzlicher Zeit bereits zur Geburtsstätte des Walzers geworden, den der fröhliche Wiener Kongress (1814-15) bald in ganz Europa populär machte. Der lebenslustige Walzer, der als beliebter Gesellschaftstanz rasch das alte Menuett verdrängte, stammte von dem in den Alpenregionen weit verbreiteten >Ländler< her - Johann Strauß Vater (1804-1843) und Joseph Lanner (1801-1843) erhoben ihn zum Kunsttanz, der nach den langen, vorangegangenen Spannungen von Revolutionskrieg und gesellschaftlicher Umwälzung rasch Furore machte.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts tritt Wien durch das Wirken mehrerer Männer noch einmal an die Spitze des europäischen Musikgeschehens - es sind die Symphoniker Johannes Brahms (1833-1897), Anton Bruckner (1824-1896) und Gustav Mahler (1860-1911) sowie der feinsinnige Liedschöpfer Hugo Wolf (1860-1903). Diese Stellung als führende Musikstadt manifestierte sich ebenso durch die >Internationale Ausstellung für Musik und Theaterwesen< (1892) wie auch durch den schon 1864 von der Universität errichteten Lehrstuhl für Musikgeschichte und Ästhetik, den Eduard Hanslick und Guido Adler zu einem höchst bedeutsamen Forschungsplatz erhoben.
Gleichsam nebenbei erreichte die leichte Musik ihren absoluten Höhepunkt durch Johann Strauß Sohn (1825-1899), der das Werk seines Vaters vollendete und in aller Welt verbreitete. Seine Brüder Joseph und Eduard sowie Carl Michael Ziehrer, Karl Zeller und Karl Millöcker sind weitere Protagonisten der heiteren Muse.
1869 bezog die Hofoper ihr neues Haus am Ring, ab 1908 wurde die heutige Volksoper als zweite Opernbühne geführt; daneben waren Musikvereinssaal und das 1912-13 errichtete Konzerthaus ebenso bedeutende Pflegestätten der Wiener Musik.
Während ein Anton Bruckner, dessen Tragik es wohl blieb, dass die absolute Musik finanziell weit im Wert hinter den Bühnenkompositionen zurücksteht, kläglich in Wien dahinvegetiert und Hugo Wolf seiner Krankheit verfällt, avanciert der Symphoniker und Liederkomponist Gustav Mahler unter dem vielfach als >rückständig< bezeichneten Kaiser Franz Joseph immerhin zum selbstständig experimentierenden Direktor und Dirigenten der Hofoper in Wien (1897). Mahler eröffnet damit die vielleicht wichtigste Ära der Wiener Operngeschichte überhaupt, die der letzten Konsequenz des >Diensts am Werk< verpflichtet bleibt - noch viel spätere Konzeptionen beriefen sich wiederholt auf Mahlers hohe Ansprüche sowie auf sein nahezu ideales Opernmanagement (18).
2. Kapitel
MAXIMILIAN I. UND DIE HOFMUSIK DES 15. JAHRHUNDERTS - CELTIS ODERDIE VORWEGNAHME DER BAROCKOPER - DAS JESUITENTHEATER IM SCHOLARENHAUS - DER REICHSTAG FERDINANDS III. ALS MUSIKALISCHES GROSSEREIGNIS (1653)
Das glänzende Vorbild höfischer Musikpraxis gibt gegen Ende des 15. Jahrhunderts die Hofkapelle Kaiser Maximilians (1459-1519), dessen diverse Hoflager in Innsbruck, Augsburg, Konstanz und Wien ohne Musikkapelle geradezu undenkbar war. Der von Albrecht Dürer verewigte Triumphzug beweist nachhaltig, wie sehr die Künstler geehrt und anerkannt wurden (1). So spielt beispielsweise der Salzburger Paul Hofhaimer, den sogar ein Paracelsus bewunderte, auf einem fahrenden Wagen die Orgel. Darunter stehen die Verse: "... Aufs allerpest nach Maisterschafft / Wie dann der Kaiser hat geschafft". - Maximilians Geheimschreiber berichtet im so genannten >Weisskunig< (1512) bereits über den Herrscher: "Dan hat er aufgericht ain söliche cantarey mit ainem sölichen gesang von der menschen stym, wunderlich zu hören, und sölich libliche harpfen von newen werken und mit suessem saytenspil, dass er alle kunig ubertraf" - (Dann hat er eine selige Kantorei errichtet mit einem seligen Gesang von der Menschen Stimme, und selig lieblichen Harfen von neuen Werken und mit seligen Saitenspiel, so dass er alle Könige übertraf). - Eines der wichtigsten musikhistorischen Zeugnisse dieser Zeit bleibt das 1544 erschienene >Liederbuch< Wolfgang Schmelzls (1500-1557), eines Schulmeisters bei den Schotten in Wien, der sich bereits den modernen italienischen Kompositionen annäherte - einem Stil, der allmählich über die Gregorianischen Choralwerke triumphieren sollte.
Читать дальше