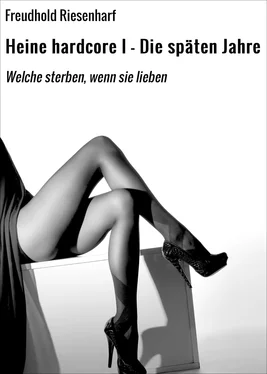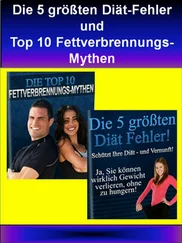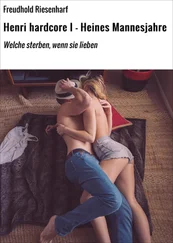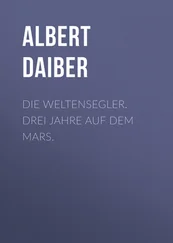1 ...8 9 10 12 13 14 ...17 Tamora ist ein schönes majestätisches Weib, eine bezaubernd imperatorische Gestalt, auf der Stirn das Zeichen der gefallenen Göttlichkeit, in den Augen eine weltverzehrende Wollust, prachtvoll lasterhaft, lechzend nach rotem Blut. Weitblickend milde, wie unser Dichter sich immer zeigt, habe er schon in der ersten Szene, wo Tamora erscheint, alle die Greuel, die sie später gegen Titus Andronicus ausübt, im voraus justifiziert. Denn dieser starre Römer, ungerührt von ihren schmerzlichsten Mutterbitten, lässt ihren geliebten Sohn gleichsam vor ihren Augen hinrichten; sobald sie nun, in der werbenden Gunst des jungen Kaisers, die Hoffnungsstrahlen einer künftigen Rache erblickt, entringeln sich ihren Lippen die jauchzend finsteren Worte:
Ich will es ihnen zeigen, was es heißt,
Wenn eine Königin auf den Straßen knieet,
Und Gnad umsonst erfleht ...
Wie ihre Grausamkeit entschuldigt werde durch das erduldete Übermaß von Qualen, so erscheine die metzenhafte Liederlichkeit, womit sie sich sogar einem scheußlichen Mohren hingibt, gewissermaßen veredelt durch die romantische Poesie, die sich darin ausspricht. Ja, zu den schauerlich süßesten Zaubergemälden der romantischen Poesie gehöre jene Szene, wo während der Jagd die Kaiserin Tamora ihr Gefolge verlassen hat und ganz allein im Walde mit dem geliebten Mohren zusammentrifft.
Warum so traurig, holder Aaron?
Da doch umher so heiter alles scheint.
Die Vögel singen überall im Busch,
Die Schlange liegt im Sonnenstrahl gerollt,
Das grüne Laub bebt von dem kühlen Hauch
Und bildet bunte Schatten auf dem Boden.
Im süßen Schatten, Aaron, lass uns sitzen,
Indes die Echo schwatzhaft Hunde äfft,
Und widerhallt der Hörner hellen Klang,
Als sei die Jagd verdoppelt; – lass uns sitzen
Und horchen auf das gellende Getöse.
Nach solchem Zweikampf, wie der war, den Dido –
Erzählt man – mit Äneas einst genoss,
Als glücklich sie ein Sturmwind überfiel
Und die verschwiegne Grotte sie verbarg,
Lass uns verschlungen beide, Arm in Arm,
Wenn wir die Lust genossen, goldnem Schlaf
Uns überlassen; während Hund und Horn
Und Vögel mit der süßen Melodie
Uns das sind, was der Amme Lied ist, die
Damit das Kindlein lullt und wiegt zum Schlaf.
Während aber Wollustgluten aus den Augen der schönen Kaiserin hervorlodern und über die schwarze Gestalt des Mohren wie lockende Lichter, wie züngelnde Flammen ihr Spiel treiben, denkt dieser an weit wichtigere Dinge, an die Ausführung der schändlichsten Intrigen, und seine Antwort bildet den schroffsten Gegensatz zu der brünstigen Anrede Tamoras.
Am 29. August des Jahres 1827 sei es gewesen, als er im Theater zu Berlin bei der ersten Vorstellung einer neuen Tragödie vom Herrn E. Raupach allmählich einschlief. Für das gebildete Publikum, das nicht ins Theater geht und nur die eigentliche Literatur kennt, müsse er hier bemerken, dass benannter Herr Raupach ein sehr nützlicher Mann sei, ein Tragödien- und Komödienlieferant, welcher die Berliner Bühne jeden Monat mit einem neuen Meisterwerk versehe. Die Berliner Bühne sei eine vortreffliche Anstalt und besonders nützlich für Hegelsche Philosophen, welche des Abends von dem harten Tagwerk des Denkens ausruhen wollen. Der Geist erhole sich dort noch weit natürlicher als bei Wisotzki. Man geht ins Theater, streckt sich nachlässig hin auf die samtnen Bänke, lorgniert die Augen seiner Nachbarinnen oder die Beine der auftretenden Mimin, und wenn die Kerls von Komödianten nicht gar zu laut schreien, schläft man ruhig ein, wie ich es wirklich getan am 29. August des Jahres 1827 nach Christi Geburt .
Indes wolle er die dramatischen Gedichte, worin Shakespeare die großen Begebenheiten der englischen Historie verherrlichte, nicht dogmatisch erläutern, sondern nur die Bildnisse der Frauen, die aus jenen Dichtungen hervorblühen, mit einigen Wortarabesken verzieren! Da in den englischen Geschichtsdramen die Frauen nichts weniger als die Hauptrolle spielen und der Dichter sie nie auftreten lässt, um wie in anderen Stücken weibliche Gestalten und Charaktere zu schildern, sondern vielmehr, weil die darzustellende Historie ihre Einmischung erforderte: so werde auch er desto kärglicher von ihnen reden. – In König Heinrich VI . sehen wir Margaretha, die schöne Tochter des Grafen Reignier, noch als Mädchen. Suffolk tritt auf und führt sie als Gefangene vor, doch ehe er sich dessen versieht, hat sie ihn selber gefesselt. Er mahne uns ganz an den Rekruten, der von einem Wachtposten aus seinem Hauptmann entgegenschrie: „Ich habe einen Gefangenen gemacht.“ – „So bringt ihn zu mir her“, antwortet der Hauptmann. – „Ich kann nicht“, erwiderte der arme Rekrut, „denn mein Gefangener lässt mich nicht mehr los.“
Suffolk spricht:
Sei nicht beleidigt, Wunder der Natur!
Von mir gefangen werden, ist dein Los.
So schützt der Schwan die flaumbedeckten Schwänlein,
Mit seinen Flügeln sie gefangenhaltend:
Allein, sobald dich kränkt die Sklaverei,
So geh und sei als Suffolks Freundin frei.
Sie wendet sich weg, als wollte sie gehn .
O bleib! Mir fehlt die Kraft, sie zu entlassen,
Befrein will sie die Hand, das Herz sagt nein.
Wie auf kristallnem Strom die Sonne spielt
Und blinkt mit zweitem nachgeahmten Strahl,
So scheint die lichte Schönheit meinen Augen;
Ich würbe gern, doch wag ich nicht zu reden;
Ich fordre Tint und Feder, ihr zu schreiben.
Pfui, De la Poole! entherze dich nicht selbst.
Hast keine Zung? ist sie nicht dort?
Verzagst du vor dem Anblick eines Weibs?
Ach ja! der Schönheit hohe Majestät
Verwirrt die Zung und macht die Sinne wüst.
MARGARETHA: Sag, Graf von Suffolk (wenn du so dich nennst),
Was gilt's zur Lösung, eh du mch entlässest?
Denn wie ich seh, bin ich bei dir Gefangne.
SUFFOLK beiseit : Wie weißt du, ob sie deine Bitte weigert,
Eh du um ihre Liebe dich versucht?
MARGARETHA: Du sprichst nicht: was für Lösung muss ich
zahlen?
SUFFOLK beiseit : Ja, sie ist schön, drum muss man um sie werben;
Sie ist ein Weib, drum kann man sie gewinnen.
Endlich findet er doch das beste Mittel, die Gefangene zu behalten: indem er sie seinem König anvermählt und zugleich ihr öffentlicher Untertan und ihr heimlicher Liebhaber wird.
Ist dieses Verhältnis zwischen Margarethen und Suffolk in der Geschichte begründet? Er wisse es nicht. Aber Shakespeares divinatorisches Auge sehe oft Dinge, wovon die Chronik nichts melde, und die dennoch wahr sind. Er kenne sogar jene flüchtigen Träume der Vergangenheit, die Klio aufzuzeichnen vergaß. Bleiben vielleicht auf dem Schauplatz der Begebenheiten allerlei bunte Abbilder derselben zurück, die nicht wie gewöhnliche Schatten mit den wirklichen Erscheinungen verschwinden, sondern gespenstisch haften bleiben am Boden, unbemerkt von den gewöhnlichen Werkeltagsmenschen, die ahnungslos darüber hin ihre Geschäfte treiben, aber manchmal ganz farben- und formenbestimmt sichtbar werdend für das sehende Auge jener Sonntagskinder, die wir Dichter nennen? – Hat Shakespeare wirklich den Charakter des erwähnten Königs ganz treu nach der Historie geschildert? Ich muss wieder auf die Bemerkung zurückkommen, dass er verstand, die Lakunen der Historie zu füllen.
Die Gunst der Frauen, wie das Glück überhaupt – bemerkt er zu Lady Anna aus König Richard III . –, ist ein freies Geschenk, man empfange es, ohne zu wissen, wie, ohne zu wissen, warum. Es gebe aber Menschen, die es mit eisernem Willen vom Schicksal zu ertrotzen verstehen, und diese gelangen zum Ziel, entweder durch Schmeichelei, oder indem sie den Weibern Schrecken einflößen, oder indem sie ihr Mitleiden anregen, oder indem sie ihnen Gelegenheit geben, sich aufzuopfern … Letzteres, nämlich das Geopfert-Sein, ist die Lieblingsrolle der Weiber und kleidet sie so schön vor den Leuten, und gewährt ihnen auch in der Einsamkeit so viel tränenreiche Wehmutsgenüsse.
Читать дальше