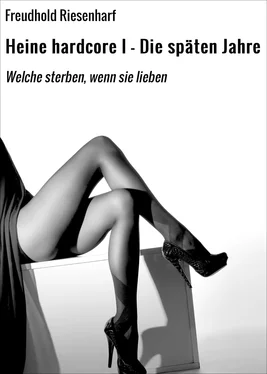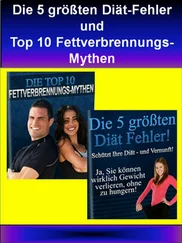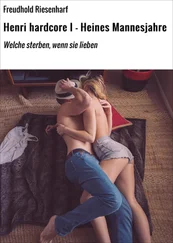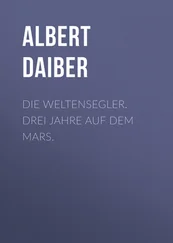1 ...7 8 9 11 12 13 ...17 Mit welcher beginnen? Mit Cleopatra und wie sie dem Markus Antonius den Kopf verdreht? Er erinnert sich seiner faustischen Visionen bei der ersten Fahrt nach Vinot, und wie er die schöne Griechin Helena heraufbeschwor. In Shakespeares Troilus und Cressida findet er sie wieder, zusammen mit Leda, der Tochter des Königs Thestios und der Eurythemis, die von Zeus in Gestalt eines Schwans sodomitisch geschwängert wurde:
Abwechselnd wieder sah man hier skulptiert
Des geilen Jovis Brunst und Freveltaten,
Wie er als Schwan die Leda hat verführt,
Die Danae als Regen von Dukaten.
Yeats Gedicht, zitiert von Portnoy, wäre Henris Feder würdig:
Ein jäher Stoß: die Schwinge, bebend, packt
die Taumelnde; der Schwimmhaut schwarze Lust
greift um das Schenkelpaar; der Schnabel hackt
sich ins Genick, und Brust presst sich auf Brust.
Wie könnte jene angstverwirrte Hand
so weiße Pracht von willigen Schenkeln wehren?
Und wie der Leib, vom Fittich übermannt,
so fremden Herzens Klopfen überhören?
Ein blindes Schaudern in den Lenden schaut
der Mauer Sturz, Glut im Gebälk entfacht,
und Agamemnons Tod.
Die's also graut
vorm Blut der Luft, das wild herniederstieß:
gehörte ihr das Wissen seiner Macht,
eh sie der Schnabel lässig fallen ließ?
Das also ist die schöne Helena, deren Geschichte er uns nicht ganz erzählen und erklären könne; er müsste denn wirklich mit dem Ei der Leda beginnen. Ihr Titularvater hieß Tyndarus, aber ihr wirklicher geheimer Erzeuger war ein Gott, der in der Gestalt eines Vogels ihre gebenedeite Mutter Leda befruchtet hatte, wie dergleichen im Altertum oft geschah. Früh verheiratet ward sie nach Sparta; doch bei ihrer außerordentlichen Schönheit ist es leicht begreiflich, dass sie dort bald verführt wurde und ihren Gemahl, den König Menelaus, zum Hahnrei machte.
Meine Damen, wer von euch sich ganz rein fühlt, werfe den ersten Stein auf die arme Schwester! Damit wolle er nicht sagen, dass es keine ganz treuen Frauen gäbe. Sei doch schon das erste Weib, die berühmte Eva, ein Muster ehelicher Treue gewesen. Ohne den leisesten Ehebruchsgedanken wandelte sie an der Seite ihres Gemahls, des berühmten Adam, der damals der einzige Mann in der Welt war und ein Schurzfell von Feigenblättern trug. Nur mit der Schlange konversierte sie gern, aber bloß der schönen französischen Sprache wegen, die sie sich dadurch aneignete, wie sie denn überhaupt nach Bildung strebte. O ihr Evastöchter, ein schönes Beispiel hat euch eure Stammmutter hinterlassen! ...
Frau Venus, die unsterbliche Göttin aller Wonne, verschaffte dem Prinzen Paris die Gunst der schönen Helena; er verletzte die heilige Sitte des Gastrechts und entfloh mit seiner holden Beute nach Troja, der sichern Burg … was wir unter solchen Umständen ebenfalls alle getan hätten. Wir alle, – darunter verstehe er ganz besonders uns Deutsche, die wir gelehrter seien als andere Völker und uns von Jugend auf mit den Gesängen des Homers beschäftigen. Die schöne Helena ist unser frühester Liebling, und schon im zarten Knabenalter, wenn wir auf den Schulbänken sitzen und der Magister uns die schönen griechischen Verse expliziert, wo die trojanischen Greise beim Anblick der Helena in Entzückung geraten:
Leise redete mancher und sprach die geflügelten Worte:
Tadelt nicht die Troer und hellumschienten Achaier,
Die um ein solches Weib so lang ausharren im Elend!
Einer unsterblichen Göttin fürwahr gleicht jene von Ansehn!
– … dann pochen schon die süßesten Gefühle in unserer jungen unerfahrnen Brust … Mit errötenden Wangen und unsicherer Zunge antworten wir auf die grammatischen Fragen des Magisters … Späterhin, wenn wir älter und ganz gelehrt, und sogar Hexenmeister geworden sind und den Teufel selbst beschwören können, dann begehren wir von dem dienenden Geist, dass er uns die schöne Helena von Sparta verschaffe.
Er, Heine, habe es schon einmal gesagt: der Johann Faust sei der wahre Repräsentant der Deutschen, des Volkes, das im Wissen seine Lust befriedigt, nicht im Leben. Obgleich dieser berühmte Doktor, der Normal-Deutsche, endlich nach Sinnengenuss lechzt und schmachtet, sucht er den Gegenstand der Befriedigung keineswegs auf den blühenden Fluren der Wirklichkeit, sondern im gelehrten Moder der Bücherwelt; und während ein französischer oder italienischer Nekromant von dem Mephistopheles das schönste Weib der Gegenwart gefordert hätte, begehrt der deutsche Faust ein Weib, welches bereits vor Jahrtausenden gestorben ist und ihm nur noch als schöner Schatten aus altgriechischen Pergamenten entgegenlächelt, die Helena von Sparta! Wie bedeutsam charakterisiert dieses Verlangen das innerste Wesen des deutschen Volkes!
Der typische Deutsche begehrt ein Weib als schönen Schatten? Das ist nicht ohne tiefere Wahrheit. Aber nicht, dass die schöne Helena der Literatur entstammt, scheint das Entscheidende, sondern dass sie überhaupt keine reale Gestalt ist, sondern allein ein Geschöpf der Phantasie, und zwar der erotischen Phantasie. Vielleicht sucht Faust die Sehnsucht, die ihm die literarische Phantasie einflößte, ja wiederum bloß in der Phantasie zu befriedigen. Ob das spezifisch für den ,Deutschen' ist, lassen wir dahingestellt; scheint diese Art Befriedigung durch die Phantasie doch eher ein weltweit verbreitetes, allgemeinmenschliches Phänomen! –
Neben der schönen Helena ist es Cressida, die ehrenfeste Tochter des Priesters Kalchas, die er hier dem verehrungswürdigen Publikum zuerst vorführe. Pandarus war ihr Oheim: ein wackerer Kuppler; seine vermittelnde Tätigkeit wäre jedoch schier entbehrlich gewesen. Troilus, ein Sohn des vielzeugenden Priamus, war ihr erster Liebhaber; sie erfüllte alle Formalitäten, sie schwur ihm ewige Treue, brach sie mit gehörigem Anstand und hielt einen seufzenden Monolog über die Schwäche des weiblichen Herzens, ehe sie sich dem Diomedes ergab. Der Horcher Thersites, welcher ungalanterweise die Dinge immer beim Namen nennt, nennt sie eine Metze. Aber er wird wohl einst seine Ausdrücke mäßigen müssen; denn es kann sich wohl ereignen, dass die Schöne, von einem Helden zum andern und immer zum geringeren hinabsinkend, endlich ihm selber als süße Buhle anheimfällt.
Wenn er dieses Drama unter der Rubrik ,Tragödien' einregistriere, so wolle er dadurch von vornherein zeigen, wie streng er es mit solchen Überschriften nehme. Sein alter Lehrer der Poetik im Gymnasium zu Düsseldorf habe einmal sehr scharfsinnig bemerkt: „Diejenigen Stücke, worin nicht der heitere Geist Thalias, sondern die Schwermut Melpomenes atmet, gehören ins Gebiet der Tragödie.“ Vielleicht habe er jene umfassende Definition im Sinn gehabt, als er auf den Gedanken geriet, Troilus und Cressida unter die Tragödien zu stecken. Und in der Tat, es herrsche darin eine jauchzende Bitterkeit, eine weltverhöhnende Ironie, wie sie uns nie in den Spielen der komischen Muse begegne. Es sei weit eher die tragische Göttin, welche überall in diesem Stück sichtbar werde, nur dass sie hier einmal lustig tun und Spaß machen möchte … Und es ist, als sähen wir Melpomene auf einem Grisettenball den Chahut tanzen, freches Gelächter auf den bleichen Lippen und den Tod im Herzen.
Auch die Kaiserin Tamora aus Titus Andronicus sei, im Gegensatz zur keuschen Lavinia, eine schöne Figur; es dünke ihn eine Ungerechtigkeit, dass der englische Grabstichel in gegenwärtiger Galerie Shakespearescher Frauen ihr Bildnis nicht eingezeichnet habe. Obgleich in Titus Andronicus noch das äußere Gepränge des Heidentums walte, so offenbare sich darin doch schon der Charakter der späteren christlichen Zeit, und die moralische Verkehrtheit in allen sittlichen und bürgerlichen Dingen sei schon ganz byzantinisch. Dieses Stück gehöre sicher zu Shakespeares frühesten Erzeugnissen, obgleich manche Kritiker ihm die Autorschaft streitig machten; es herrsche darin eine Unbarmherzigkeit, eine schneidende Vorliebe für das Hässliche, ein titanisches Hadern mit den göttlichen Mächten, wie wir dergleichen in den Erstlingswerken der größten Dichter zu finden pflegen. Der Held, im Gegensatz zu seiner ganzen demoralisierten Umgebung, sei ein echter Römer, ein Überbleibsel aus der alten starren Periode. Ob dergleichen Menschen damals noch existierten? Es sei möglich; denn die Natur liebe es, von allen Kreaturen, deren Gattung untergeht oder sich transformiert, noch irgendein Exemplar aufzubewahren, und sei es auch als Versteinerung, wie wir dergleichen auf Bergeshöhen zu finden pflegen. Titus Andronicus ist ein solcher versteinerter Römer, und seine Tugend ist eine wahre Kuriosität zur Zeit der späteren Cäsaren.
Читать дальше