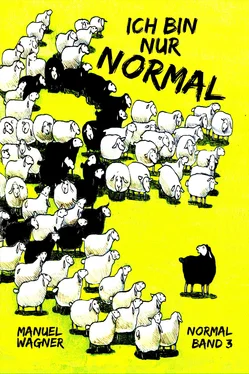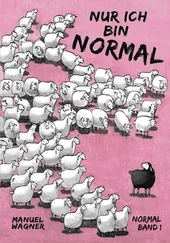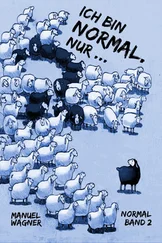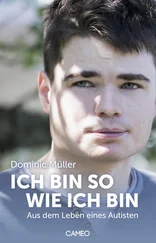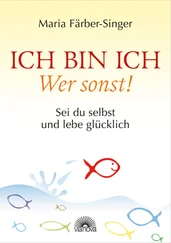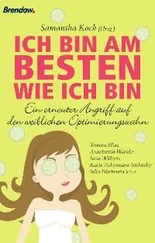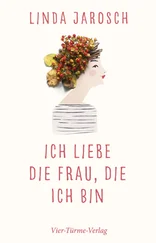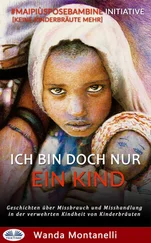Die sozionormalisierende Gehirnbehandlung hat etwas sehr hilfreiches zu Tage gefördert. Weil sich die immer zahlreicher werdenden Sozionormalen ihrer selbst und ihren Bedürfnissen sehr bewusst sind, bekommen sie eine neutrale Sicht auf alle anderen Menschen. Sie handeln immer stärker, als befänden sie sich unter dem Schleier des Nichtwissens. Das bedeutet, sie agieren so, als wüssten sie nicht, welche Position sie selbst in der Gesellschaft haben werden, während sie die Gesellschaftsordnung mit all ihren Regeln und Umverteilungsmechanismen entwerfen. Sie tun vor gesellschaftlichen Entscheidungen so, als könnten sie selbst Habenichtse aus indischen Slums oder superreiche Unternehmererben sein. Wenn man um seinen Status in der Gesellschaft nicht weiß, beziehungsweise ihn einfach außer Acht lässt, stellt man automatisch die für alle gerechtesten Regeln auf (vgl. Rawls, John: Gerechtigkeit als Fairneß, übers. von Joachim Schulte, Frankfurt a. M. 2003). Ethisch betrachtet, ist das Vorgehen unter dem Schleier des Nichtwissens das Beste, was ein Mensch, eine Gesellschaft tun kann. Die Idee, die John Rawls entwickelt hat, hatte in der soziomanen Welt ein Problem: Man musste sich selbst dazu zwingen, nach dem Schleier des Nichtwissens zu denken, denn das soziomane Gehirn ist viel stärker egoistisch programmiert. Im soziomanen Gehirn drehen sich die Gedanken meistens darum, wie man seinen eigenen Status in Bezug auf die Gruppe verbessern kann. Das führt zu Gier nach Geld, nach Anerkennung, nach Macht. Durch die sozionormale Behandlung können die Menschen gar nicht mehr so denken. Sozionormale können diese erhabene Position des scheinbaren Nichtwissens um die eigene Position einnehmen.
Der Schleier des Nichtwissens blendet Egoismen völlig aus. Da man nicht wissen kann, als was man geboren wird und welche guten oder schlechten Dinge einem im Leben passieren werden, betrachtet man alle Menschen als gleichberechtigt; kein Naserümpfen über Obdachlose, keine Ressentiments gegenüber Kopftuchträgern oder Glatzköpfen. Jeder einzelne Mensch versetzt sich automatisch in andere Menschen hinein und vergisst für einen Moment, dass das aktuelle Ich eine Konstante ist. Man stellt sich vor, dass ein Ich-Tausch mit anderen Menschen jederzeit möglich wäre. Dadurch ist man bestrebt, Bedingungen zu schaffen, unter denen ein vermeintlich unbegabter, arm geborener Mensch genauso glücklich wird wie ein Mensch, der durch pures Glück bei der Geburt begabter und reicher ausgestattet wurde. Der Schleier des Nichtwissens verschweigt sozusagen das eigene Ich für einen Moment und sagt stattdessen: »Du weißt nicht, wer du bist. Du könntest jeder sein. Was wäre, wenn du vom Schicksal gezwungen derjenige sein müsstest, dem es gerade am schlechtesten geht? Dann wäre es notwendig, dass dir sofort am meisten geholfen wird.« Das hat in der Praxis nicht nur in Bezug auf Obdachlose positive Konsequenzen. Sozionormale Menschen wollen immer, dass es nicht nur ihnen selbst gut geht oder nur ihrer Familie oder ihrem engeren Umfeld, sondern auch alle anderen Menschen sollen so angenehm wie möglich leben. Deswegen setzen sich sozionormale Menschen unbefangen für gleich gute Lebensbedingungen aller ein, und zahlen beispielsweise sehr gerne Steuern. Würden sie Solidarität verweigern, spürten sie das Leid der Leidenden auch bei sich, denn sie wüssten immer, auch sie könnten der andere sein, der gerade Pech hatte. Vielleicht hat diese Art zu denken etwas Quälendes fast schon Masochistische s, aber nur das Mitfühlen hat dieses großartige Potential, eine gerechte Welt zu erschaffen, in der nicht nur kein Mensch leidet, sondern absolut jeder Mensch glücklich ist. Noch ist nicht die ganze Gesellschaft sozionormal, noch empfindet nicht jeder die »Qual« besser gesagt die Segnung des Mitfühlens, doch irgendwann werden alle Menschen so mitfühlen können, dass das Schlechte auf der Welt komplett eliminiert wird.
Ich bin mit mir wieder etwas zufriedener, als ich den Text an das Projektteam »Virtuelles Lernen und Lehren« sende. Genau wie den brennenden Smoothie brauchte ich anscheinend auch das Schreiben des Textes. Alles ist gut, so wie es ist... so wie es wird.
»Sehr gut. Da haben wir ja den Übeltäter, der dich einfach nicht in Ruhe lassen wollte und dich nicht schlafen ließ«, kommentiert der Neurologe sein Tun in meinem Kopf.
Ein merkwürdiges Gefühl überkommt mich, jetzt wo ich die Prozedur hinter mir habe. Kennt ihr auch das Gefühl, dass ihr gerade einen unglaublich spannenden, erzählenswerten Traum hattet, aber ihr ihn Sekunden nach dem Aufwachen wieder vergessen habt? Genau so fühle ich mich jetzt, als ob ich etwas seltsames geträumt hätte, an das ich mich nun nicht mehr erinnere. Wenn auch ein wenig anders, empfinde ich das Gefühl als vergleichbar. Jedoch geht es bei besagter Prozedur nicht um das Vergessen absurder, witziger oder gar erotischer Träume, sondern um Gedanken, die einen wach gehalten haben, Gedanken, die jede ruhige Minute im Kopf nutzten, um vermeintliche Probleme derartig aufwendig in Szene zu setzen, dass man meinte, man könne nicht weiterleben, wenn man diese vermeintlichen Probleme nicht sofort löst. Das tückische ist nur, dass es sich dabei immer um Probleme handelt, die im Moment des Nachdenkens unlösbar sind, weil das Hirn mit irgendwelchen vergangenen Ereignissen im Kopf herumjongliert und dabei zum Beispiel vermeintliche Missverständnisse oder sogar Peinlichkeiten aufdeckt, die einem bei der Kommunikation mit Menschen passiert sein sollen. Hat man sich vielleicht aus Versehen in der Bäckerschlange vorgedrängelt? Wurde man beim Wechselgeld betrogen? Hatte man sich im Meeting derart unklar ausgedrückt, dass niemand wusste, was man sagen sollte? Ich weiß auch nicht, welcher dumme Umstand in der Evolutionsgeschichte unserem Gehirn diese sinnlose Angewohnheit des unlösbaren Gedankenkreisens verpasst hat.
Allerdings, was mich zuletzt um den Schlaf hätte bringen können, kann ich euch jetzt nicht mehr sagen. Ich sitze hier mit einer Haube auf dem Kopf, die voller Elektroden ist, die sowohl Gehirnströme empfangen als auch Strahlung und Wellen verschiedenster Art zielgerichtet in alle möglichen Bereiche meines Gehirns senden können. Die Prozedur, bei der man bestimmte Gedanken genauer gesagt Emotionen löscht, ist etwas unangenehm, denn das zuvor eingenommene Konzentrin sorgt dafür, dass man die fehlerhaften Gedanken zuerst einmal sehr intensiv erlebt, so dass man wirklich kein Stück mehr vom Unangenehmen abschweifen kann. Aber nur so kann garantiert werden, dass der Arzt den zu löschenden Gedanken im Gehirn richtig erkennen kann und nicht aus Versehen einen Gedanken entfernt, der eigentlich nicht gelöscht werden sollte. Ohne das Konzentrin könnte zu viel, zu wenig oder falsch gelöscht werden.
»So, waren das alle Gedanken aus deiner fürchterlichen Schulzeit?«
Ich überlege kurz. »Im Moment fallen mir keine dieser kleinen aber stetig nervenden Gedanken mehr ein, die in letzter Zeit unerträglich in meinem Kopf gekreist sind.«
»Jetzt, wo du weißt, wie es sich anfühlt, können wir uns an die tiefer sitzenden traumatischen Gedanken wagen.« Der Neurologe sieht mich besorgt an. »Es ist sehr wahrscheinlich, dass es jetzt heftig wird. Ich kenne schließlich deine Geschichte, aber danach kannst du schlafen wie ein komatöses Baby.«
Ich weiß, was der Arzt meint, aber eigentlich raubt mir das Attentat nicht mehr den Schlaf. Jedoch gehe ich davon aus, es hat nachhaltig etwas in mir verändert. Auch wenn ich noch oft daran denke, wie man versuchte, mich zu töten, andere unbedeutende Kleinigkeiten wie ein doofer Spruch von einem Lehrer vor langer Zeit oder von irgendeinem Mitschüler, dessen Namen und Gesicht ich längst vergessen habe, fand ich bisher viel schlafraubender. Trotzdem kann es nicht schaden, dieses wahrscheinlich tief sitzende Trauma, was von weit unten immer wieder versucht, nach meiner Seele zu greifen, zu vernichten. Ich konzentriere mich also mit aller Kraft auf den Moment, als ich von der jungen Frau niedergestochen wurde. Mir wird schnell klar, der Arzt hat mich zu Recht gewarnt, es wird geradezu unerträglich intensiv, aber selbst wenn ich wollte, ich bin durch das Konzentrin nicht mehr fähig den Gedanken zu stoppen.
Читать дальше