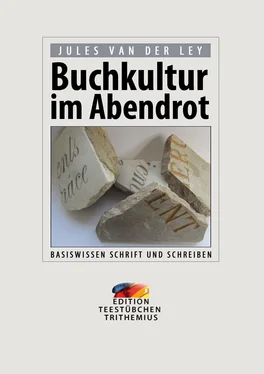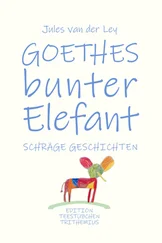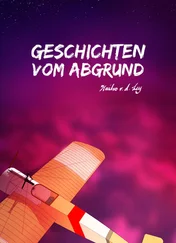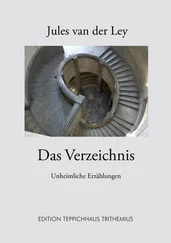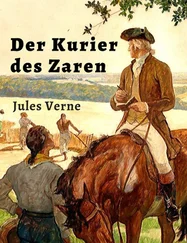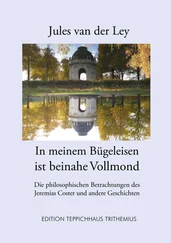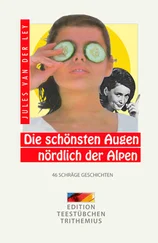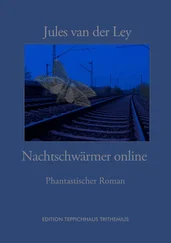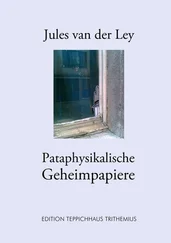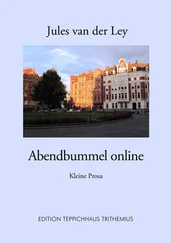Texte im Internet, besonders in Foren oder Kommentarkästen sind in der Regel den mündlichen Äußerungen näher. Sie können in rascher Wechselseitigkeit entstehen.
Besonders der Faktor der Zeitnähe erlaubt keine geistige Distanzierung, kein Zurücklehnen zur Reflexion. Hinzu kommt eine gefühlsmäßige Beteiligung, eine innere Unruhe und Aufregung, die wir aus der gedruckten Schriftlichkeit nicht kennen, gegen die wir folglich nicht gewappnet sind.
Bei Diskussionen im Netz entsteht ein virtueller Stammtisch, auf dem Zettelbotschaften hin- und hergeschoben werden, die kaum einer noch richtig liest und versteht. Vor allem aber geht mit der anwachsenden Flut von Zetteln der Überblick verloren, weil es ermüdende Lesearbeit und strapazierende Erinnerung erfordern würde noch zu wissen, was bereits wie worüber gesagt wurde. So fallen bereits nach dreimaligem Hin und Her Sinn und Verstand unter den Tisch und werden ersetzt durch Emotionen. Da scheint sich zu bewahrheiten, was der Medienphilosoph Vilém Flusser schon 1990 angenommen hat, der Mensch müsse das alphabetische, lineare Denken aufgeben, wenn er sich im digitalen Zeitalter behaupten will.
Am virtuellen Stammtisch gibt es auch keine Autorität, vor allem nicht, wenn sich die Gesellschaft rein zufällig zusammenfindet. Es entsteht eine scheinbare Augenhöhe, die auch der Ungebildete selbstverständlich für sich beansprucht.
Wer sich im Dialog Aug in Aug über eine Äußerung ärgert, wird sein Gegenüber deshalb nicht beschimpfen. Da man sich aber im Internet maskiert begegnet auf einer Einkanalebene, die ihre anderen Kanäle allenfalls simuliert, können die Wogen hoch her gehen. Wer mir eine Beleidigung in Druckschrift entgegenschleudert, der aber tut es mit der weiter oben beschriebenen Macht. Da ist es fast ein Glück, dass diese Macht im Internet überstrapaziert wird und an allen Ecken und Enden bröckelt.
Diese negativen Erscheinungen treten primär in den Internetforen und im Mikroblogging auf. Andere Formen der Internetpublikation wie Weblog und E-Book sind noch stärker an den Maßstäben der Buchkultur orientiert. Hier zeigen sich die Vorzüge des neuen Mediums. Denen ist der folgende Abschnitt gewidmet.
Die Herrschaft über Kommunikationsmittel sichert Macht über Köpfe – Zu den Vorteilen des digitalen Publizierens
Wer bei uns in ein Wahllokal geht, um auf einem Wahlzettel sein analphabetisches Kreuzchen zu machen, darf natürlich kein Analphabet sein, denn die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben ist erforderlich, wenn man an einer Alphabetkultur gesellschaftlich teilhaben will. Das gilt besonders für die Teilhabe an einer demokratisch organisierten Kultur. Die demokratische Teilhabe ist nicht selbstverständlich und steht auch nicht am Anfang der Entwicklung unserer Alphabetkultur. Noch Ende des 19. Jahrhunderts war Geläufigkeit im Lesen und Schreiben nicht das erklärte Bildungsziel. 1872 schreibt der preußische Konsistorialrat Münchmeyer:
“Wo keine Lust zum Lesen ist, rege man sie nicht an. Es ist nicht zu wünschen, dass der Bauer Zeitungen liest, auch das Verlangen nach guter Lektüre soll, wenigstens unter Landleuten, nicht hervorgerufen werden.”
Im Jahr 1878 schreibt Staatsminister Hofmann anlässlich der ersten Beratung des Gesetzentwurfes zur Abwehr sozialdemokratischer Ausschreitungen im Reichstag:
„Wie leicht wird ferner all der gute Samen, den die Schule in das jugendliche Gemüt gestreut hat, zerstört und ausgerottet, wenn der junge Mann von dem Lesen, das er in der Schule gelernt hat, in der Weise Gebrauch macht, dass er sozialdemokratische Blätter studiert, wenn er etwa von seiner Fähigkeit im Schreiben [...] Gebrauch macht, um selbst Artikel in sozialistischen Blättern zu schreiben.“
Die Angst der herrschenden Elite, der einfache Landmann oder lohnabhängige Arbeiter könnte über das Lesen mit subversivem Gedankengut in Berührung kommen oder sogar seine Meinung schriftlich äußern und verbreiten, ist noch größer als der ökonomische Zwang zur schriftlichen Kommunikationsfähigkeit aller Bevölkerungsschichten. Der mit Beginn des 20. Jahrhundert sich abzeichnende Sinneswandel im staatlichen Bemühen um allgemeine Literalität und Bildung ist kein Akt der Menschenfreundlichkeit, sondern folgt ökonomischen Zwängen. Die sich rasch entwickelnde Wirtschaft benötigte Arbeiter, die Bedienungsanleitungen lesen konnten, Büroangestellte für die Korrespondenzen, Wissenschaftler und Ingenieure in großer Zahl, um die technische Entwicklung voranzutreiben.
Bildung steht immer unter dem Diktat der jeweiligen Machtverhältnisse, und die Bildungsinhalte hängen ebenso stark von den Bedürfnissen und Erfordernissen der Wirtschaft ab. Auch in unserer Demokratie nehmen Interessenvertreter aller wichtigen gesellschaftlichen Gruppen starken Einfluss auf die Lehrpläne, entscheiden also mit, was an den Schulen und Hochschulen gelehrt wird. Hier üben besonders die Interessenvertreter der Wirtschaft starken Druck aus, damit ihre späteren Arbeitnehmer über die erforderlichen Qualifikationen verfügen. Idealistisches Bildungsbemühen steht demnach immer im Spannungsverhältnis zwischen Erfordernissen der Wirtschaft und Bedürfnissen des Individuums nach Selbstbestimmung und Autonomie, was in den Präambeln der Schulrichtlinien „Mündigkeit“ genannt wird. Dem Sprachunterricht kommt hier große Bedeutung zu. Lernende sollen befähigt werden, Sprache als Element der Wirklichkeitserfassung zu benutzen, also zum unbevormundeten Bilden von Begriffen und mithin freiem Denken. Der Deutschdidaktiker Joachim Fritzsche hat diesen emanzipatorischen Ansatz schon in den 1970-er Jahren formuliert:
„Da Sprache durchaus ein taktisches Mittel zum Erreichen von Zwecken sein kann, da ferner die Menschen sehr unterschiedlich über dieses Mittel verfügen, erscheint es richtig, dass der Deutschunterricht alles tut, um die Ungleichheit zu beseitigen. […] Erfahrungen werden sprachlich, wenn schon nicht gemacht, so doch verarbeitet. […] Einen Sachverhalt begreifen heißt, ihn auf den Begriff zu bringen. Ich möchte dieses Begreifen, weil es etwas mit Bedeutungen zu tun hat, „semantisches Lernen“ nennen. […] Besondere Bedeutung kommt dem semantischen Lernen dort zu, wo die Sachverhalte ihre Bestimmtheit erst durch die Sprache erhalten, also im sozialen und politischen Bereich.“
Jede Minute, die ein Mensch dazu nutzt, sich hinzusetzen und schreibend seine Gedanken auszurichten, ist ein aktiver und freier Akt der Wirklichkeitsverarbeitung, ein Training der gedanklichen Begriffsbildung. Das verschafft Klarheit über die eigene Situation, man wird sich seiner selbst bewusst, denn (Zitat Fritzsche):
a) Schreiben objektiviert. Während der Sprecher, mit dem, was er sagt, eine Einheit bildet, veräußert der Schreibende seine Vorstellungen und tritt ihnen gegenüber. Er kann sich selbst beurteilen wie einen Fremden. Das Subjekt wird Text.
b) Schreiben isoliert. Der Schreibende ist auf sich selbst angewiesen; keiner springt ihm bei, wenn ihm ein Wort fehlt; aber es fällt ihm auch keiner ins Wort.
c) Schreiben provoziert. Der Schreibende muss alles, was er zum Ausdruck bringen will, verbalisieren, d.h. ihm eine verstehbare Form geben. In der geschriebenen Sprache muss alles bis zu Ende gesagt werden.
d) Schreiben fixiert. Der Schreibende legt sich beim Schreiben fest, er verpflichtet sich. Seine Äußerungen werden interpretierbar, kritisierbar, diskutierbar.
Man wird leicht sehen können, dass Schreiben im Internet ideale Voraussetzungen für semantisches Lernen bietet, an die Fritzsche noch gar nicht hat denken können. Denn …
a) Schreiben per Tastatur und Bildschirm objektiviert wesentlich stärker als die Handschrift. Der Transport in die Druckschrift macht den Text noch fremder, und so lässt er sich leichter kritisch bewerten.
Читать дальше