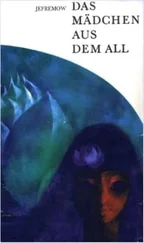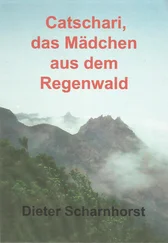Ein erster Verdacht war dem Mädchen gekommen, als sie beobachtet hatte, wie der Torabi eiligen Schritts von jener kleinen Moschee hinüber zum Grabhof ihrer Familie lief und dort von ihrem Vater in Arbeitskleidung erwartet wurde. Langsam fügten sich ihre Gedanken und Beobachtungen zu einem Ganzen: die Geschwister in dem winzigen Zimmerchen der Großeltern, die trauernde Besitzerin des Grabhofes und schließlich ihr Vater, der mit dem Torabi in der weit geöffneten Hoftür verschwand. Mit innerer Anspannung näherte sich Mona ihrem Zuhause, als gelte es, ein streng gehütetes Geheimnis zu lüften. Endlich warf sie einen Blick durch die vertraute Tür, fand im Innern des Grabhofes jedoch keineswegs ein vertrautes Bild vor. Denn dort wo die Familie noch an diesem Morgen auf dem Boden sitzend Foul (gekochte Bohnen) gegessen, wenig später Aya die Hühner gefüttert und sie selbst die weiße Galabeya, jenes kaftanartige Kleidungsstück ihres Vaters, in der alten Plastikschüssel gewaschen hatte, klaffte nun ein riesiges Loch. Gegen die linke Wand unterhalb des provisorischen Daches aus Holzlatten, welches den Bewohnern im vorderen Teil des Hofes vor leichteren Regenfällen Schutz bot, standen breite Steinplatten gelehnt. Mona wusste schon seit langem, dass sich unter ihrem Hof zwei nach Geschlechtern getrennte Grabkammern befanden. Die Mutter hatte es ihr und den älteren unter ihren Geschwistern vor einiger Zeit erzählt. Und auch, dass dort die Eltern jener Frau bestattet seien, die ihnen am Ende des Fastenmonats immer Süßigkeiten brachte. Deren Vater hat schon dort unten gelegen, als Hamdi und Nassra als junges Ehepaar hier einzogen und die Mutter der Grabbesitzerin war beigesetzt worden, als Mona noch ein Säugling war. Die unter dem Hof befindlichen mannshohen Kammern existierten für sie also nur in der Theorie. Trotz der kleinen Marmortafeln an der Wand des Hofes mit den Namen der Toten, entzogen sich jene unterirdischen Räume von jeher Monas Vorstellungsvermögen – bis zu diesem Moment. Nun blickte sie an Hanafi, dem hoch gewachsenen Torabi, vorbei in jene dunkle Höhle zu der steinerne Stufen hinunterführen.
„Wir können ihn hierher zu seinem Großvater legen“, hörte sie die Stimme ihres Vaters aus der Tiefe.
Mona trat einen Schritt näher und nun konnte sie ihn auch sehen, umhüllt von aufgewirbeltem Staub. Offenbar versuchte er mit einem Besen gleichmäßig Sand über den Boden zu verteilen.
„Nein, dazwischen kommt ja irgendwann die andere Generation … also sein Vater“, sagte der Torabi und gab die Anweisung: „Lege den Großvater einfach ein Stück nach hinten.“
Als Mona ihren Vater dabei beobachtete, wie er mit dem breiten Besen irgendetwas vor sich her in den hinteren Teil der Grabkammer schob, wurde sie von einem fremdartigen Gefühl überwältigt. Zum ersten Mal erfasste sie, was sie doch aus der Erzählung ihrer Mutter längst wusste – sie hatte ihre gesamte Kindheit in der Gegenwart jener Leichname verbracht, die dort unten lagen. War dieses seltsame Gefühl daran schuld, dass sie mit einem Mal keine Lust mehr verspürte, ihre Tante Samira zu besuchen? Oder war es schlichtweg nur die Neugier auf das, was sich gleich hier abspielen würde? Mona drängte sich an dem hünenhaften Torabi vorbei in jenen schmalen Teil des Grabhofes, den man als Küche bezeichnen könnte. Dort nämlich befand sich direkt neben dem engen Verschlag der eine Mischung aus Toilette und Dusche beherbergte, das einzige Waschbecken. Daneben stand ein wahrer Luxusgegenstand, auf dessen Besitz Monas Mutter stolz ist, seit sie ihn vor einigen Jahren in gebrauchtem Zustand auf dem Freitagsmarkt im benachbarten Stadtteil Tonsy erstanden hatte – eine halbautomatische Waschmaschine. Ein solches, für eine kinderreiche Familie äußerst sinnvolle Requisit setzte natürlich zweierlei voraus: Wasser und Strom. Tatsächlich war dieser Grabhof einer von 3529 Grabhöfen, die an die staatliche Wasserversorgung und einer von 7240, die auch an das städtische Stromnetz angeschlossen sind. Jedenfalls ist dies 1986 so gewesen, als letztmalig detaillierte Zahlen durch den Journalisten Mamdouh El Waly veröffentlicht worden waren.
Neben dieser Waschmaschine (von denen es in den Grabhöfen damals 657 gab) war Mona gelandet, nachdem sie einen großen Schritt über die geöffnete Grabkammer gemacht hatte. Zielstrebig ging sie am dreiflammigen Propangasherd vorbei, um rechts dahinter in den mit einer alten Couch und zwei Sesseln möblierten Durchgangsraum zu gelangen, der sich zwischen dem Schlafzimmer der Eltern und dem der Kinder befand. Dort gab es auch einen alten Schwarzweißfernseher, der die Grabhofbewohner medial mit dem Rest jener Welt verband, welche von ihrer Existenz kaum Notiz nahm.
Viele Leute die ich außerhalb meiner Wohngegend treffe, fragen mich, wie wir „auf diesen Gräbern da“ leben würden. Mitschülerinnen in der Mittelschule von Tonsy haben mich das oft gefragt und dann gekichert. Einige Jahre später stellten auch Kunden diese Frage, in dem Laden, in dem ich arbeitete und in dem diese Kunden elektrische Marmorschleifgeräte gemietet haben. Dabei liegt das Geschäft an dem Platz „Midan Sayeda Aisha“ direkt hinter unserem Viertel. Auch meine Mitschülerinnen in der Mittelschule wohnten ja ganz in der Nähe, in einem Wohngebiet das Imam-el-Leithy heißt. Und doch haben all diese Menschen keine Ahnung, wie wir auf den Grabhöfen leben. Auf diese Frage habe ich immer geantwortet: „Es ist mir eine Ehre auf einem Hof zu leben, denn da bin ich groß geworden und wurde von meinen Eltern, die ich über alles liebe, bestens erzogen!“ Und wenn Sie mich gefragt haben, ob ich keine Angst vor den Toten hätte, die dort überall herumlägen, sagte ich: „Warum soll ich vor ihnen Angst haben? Sie ärgern mich nicht, wie manche meiner Mitschülerinnen, die sich für was Besseres halten. Sie beleidigen mich auch nicht, wie die Leute die uns abfällig ‚diese Grabbewohner’ nennen und ihre Söhne und Töchter von uns fernhalten.“ Nein, ich habe höchstens Angst vor lebenden Menschen, nicht vor Toten. Bis zu diesem Tag aber, als der Sohn der Grabbesitzerin zu uns gebracht wurde, hatte ich nie einen Toten aus der Nähe gesehen. Auch seinen Leichnam habe ich nicht gesehen, denn er war ja in Tücher gehüllt. Dennoch hat es mich sehr bewegt, als der Torabi den Körper des Jungen aus der Holzkiste nahm und ihn an meinen Vater übergab, der damit in der Grabkammer verschwand. Ich hatte die Gardine zu unserem Wohnbereich zugezogen und das Ganze nur durch einen kleinen Spalt beobachtet. Der Torabi war der Einzige, der wusste, dass ich da war. Denn er hatte mich ja kurz zuvor kommen sehen. Nun beobachtete ich die Trauergemeinde, die im hinteren Teil des Hofes Platz nahm. Sie setzten sich auf unsere alten Stühle und Hocker, die sonst dort standen, wo nun die Steinplatten an der Wand lehnten. Während der gesamten Zeremonie verhielt ich mich ganz still und bewunderte meinen Vater, der sich um alles kümmerte.
Monas Vater kehrte aus der Tiefe der kühlen Grabkammer in die brütende Hitze zurück und sofort hat sich ein feuchter Schweißfilm auf seiner Haut gebildet. Eben noch hatte er den Leichnam des Verstorbenen auf die rechte Seite mit dem Kopf in Richtung Mekka gelegt und die Leichentücher gelockert. Hamdi hatte damit nach einer Vorschrift gehandelt, ohne zu wissen, dass sich in seinem Tun prähistorische Tradition und islamische Gegenwart vereinigten. In der Zeit der Pharaonen hatte man die Toten in Embryohaltung bestattet, weil die Erde als der Mutterleib betrachtet worden ist, aus der der Verstorbene im Jenseits wiedergeboren würde. Die Ausrichtung nach Mekka hingegen, die ja für Muslime auch beim Gebet maßgebend ist, weist zu jenem Ort, an dem der Begründer des Islam, Muḥammad ibn ’Abd Allāh ibn ’Abd al-Muṭṭalib ibn Hāšim ibn ’Abd Manāf al-Qurašī – genannt Mohammed –, in einer Höhle die Offenbarung Gottes empfangen haben soll.
Читать дальше