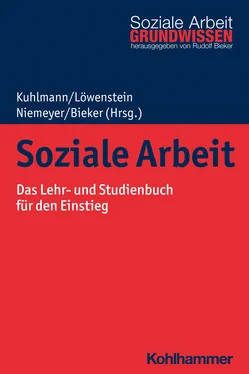Adressat*innen als Ko-Produzent*innen zu sehen, folgt – zunächst – keiner moralischen Grundhaltung, die der Unterwerfung von Menschen unter die Anweisungsmacht von kommunalen und staatlichen Behörden und ihren Mitarbeiter*innen entgegenwirken soll; sie ist eine Notwendigkeit, die sich nüchtern aus der Tatsache ergibt, dass ein direkter Zugriff Dritter auf die Dispositionen von Individuen (Sichtweisen, Motivation, Selbstreflexion, Handlungsbereitschaften etc.) nicht möglich ist. Menschen sind immer auch eigensinnige, durch ihre Biografie und ihre soziale Umwelt geprägte Subjekte, die über eigene Präferenzen, Überzeugungen, Alltagstheorien, Deutungsmuster und Gewohnheiten verfügen (Oelerich & Schaarschuch 2005, S. 80). Wenn Adressat*innen der Sozialen Arbeit demzufolge als Subjekte und nicht als Objekte ihnen zugedachter Angebote und Maßnahmen betrachtet werden müssen, liegt darin zugleich aber auch die moralische Verpflichtung, sie entsprechend zu behandeln, d. h. sie ihres Subjektstatus nicht durch fürsorgliche Bevormundung und ungerechtfertigte Gängelung und Eingriffe zu berauben. Damit dient das Subjektkonzept zugleich der kritischen Analyse von Verhältnissen, in denen Adressat*innen das Recht auf Eigensinnigkeit und Selbstbestimmung genommen wird, ohne dass hierfür zwingende Gründe (z. B. Selbst- oder Fremdgefährdung) vorliegen ( 
Kap. 1.4.2 1.4.2 Soziale Arbeit als soziale Kontrolle Bis hierin sind wir im Wesentlichen davon ausgegangen, dass die Kernaufgabe Sozialer Arbeit darin liegt, Menschen bei der Bewältigung belastender und überfordernder Lebenslagen zu unterstützen. Diese Hauptfunktion, das Hilfemandat, beruht auf Grundentscheidungen der Verfassung, die mit Begriffen wie Menschenwürde, freie Entfaltung der Persönlichkeit, dem Gleichheitsgebot und dem Sozialstaatsprinzip verbunden sind ( Kap. 5.1.2: Weitere Verfassungsprinzipien). Gegenstand der personenbezogenen Dienstleistungen sind aber nicht alleine individuelle, wie auch immer entstandene »Notlagen«, sondern auch – so bereits die Feststellung in Kapitel 1.3.2 – diverse Formen abweichenden Verhaltens (z. B. innerfamiliäre Gewalt). Abweichendes Verhalten ist zumeist kein Problem für die Person, die sich abweichend verhält, sondern ein Problem für ihre soziale Umgebung und die Gesellschaft insgesamt einschließlich ihrer Rechtsordnung. Wenn Sozialfachkräfte im Zusammenhang abweichenden Verhaltens tätig werden, geht es folglich nicht um ein Hilfebedürfnis der*des Einzelnen, sondern um das Interesse der Allgemeinheit, bestimmte Formen der individuellen Lebensführung nicht zu tolerieren. Die Tatsache, dass personenbezogene soziale Dienstleistungen einen zweifachen Adressaten haben (können), bezeichnet man als »Doppeltes Mandat« der Sozialen Arbeit (zuerst Böhnisch & Lösch 1973). Doppeltes Mandat bedeutet: Soziale Arbeit steht Menschen nicht nur bei, sie tritt ihnen auch als Repräsentantin der Gesellschaft gegenüber.
; zu ethischen Fragen des Umgangs mit anderen Menschen bei eingeschränkter Selbstbestimmung: Schmid Noerr 2021, S. 163ff.).
Schaarschuch (1999 und 2003) hat den Subjektstatus der Adressat*innen – die bei ihm Nutzer*innen genannt werden (dazu: Schaarschuch 2008) – theoretisch noch weiter zugespitzt. In dieser radikaleren Sichtweise kommt es zu einer Rollenumkehr: Die Nutzer*innen sind für Schaarschuch die Produzent*innen, Sozialfachkräfte nur Ko-Produzent*innen. Indem Nutzer*innen sich die Sichtweisen ihres Gegenübers aneignen, bewirken sie eine Veränderung ihrer Person. Die Tätigkeit der Dienstleistenden wird somit zu einem Mittel, das erst durch die aktive Anerkennung/Aneignung durch die Nutzer*innen seinen Zweck erfüllen kann (ebd., S. 156). Damit sind Nutzer*innen nicht nur Konsument*innen einer Dienstleistung, sondern auch Produzent*innen ihres Ergebnisses; Sozialfachkräfte werden zu Ko-Produzent*innen, die den Prozess der Selbstveränderung anleiten, unterstützen, begleiten und der »Produktion des Subjektes« zuarbeiten. Dadurch leisten sie einen Dienst (Oelerich & Schaarschuch 2005, S. 81).
Konsequenzen für die Beziehungsgestaltung
Wenn Soziale Arbeit hinsichtlich Verlauf (Prozess) und Ergebnis (Outcome) als Ko-Produktion zu verstehen ist, müssen Sozialfachkräfte die Perspektive ihrer jeweiligen Adressat*innen aktiv erkunden und versuchen, diese vor dem Hintergrund von Biografie und gegenwärtiger Lebenswelt ( 
Kap. 3.4
) zu verstehen.
Verstehen bedeutet nachzuvollziehen, welche Bedürfnisse und Interessen die Sichtweise des Anderen zum Ausdruck bringt und zu prüfen, ob diese gesellschaftlich anerkennungsfähig sind. Bedürfnisse können legitim sein, auch wenn die Mittel zu ihrer Verwirklichung nicht anerkennungsfähig sind. Verstehen bedeutet nicht billigen. Verstehen kann aber bedeuten, Adressat*innen Zeit für Veränderungen zuzugestehen.
Auch wenn das Verhältnis zwischen Sozialfachkräften und Adressat*innen strukturell asymmetrisch ist (z. B. durch den fachlichen Kompetenzvorsprung der Sozialfachkräfte, durch die Abhängigkeit von Hilfen, 
Kap. 1.3 1.3 Strukturelle Merkmale Sozialer Arbeit Soziale Arbeit ist durch eine Reihe struktureller, d. h. von dem Handeln der jeweiligen Sozialfachkraft unabhängige Eigenheiten gekennzeichnet. Zur Beantwortung der Ausgangsfrage »Was ist Soziale Arbeit?« sollen diese Eigenheiten, Besonderheiten und Merkmale im Folgenden herausgearbeitet werden. Die Strukturmerkmale Sozialer Arbeit stellen zentrale Rahmenbedingungen dar, innerhalb derer sich das berufliche Handeln von Sozialfachkräften abspielt. Welchen Einfluss diese Strukturmerkmale auf das berufliche Handeln der Sozialarbeiter*innen haben, hängt z. T. auch von den Akteur*innen selbst ab (Nutzung von Spielräumen).
), erfordert der Subjektstatus der Adressat*innen, diesen ohne Helfer- bzw. Überlegenheitsattitüde zu begegnen und die Kommunikation so weit wie möglich auf Augenhöhe zu führen. Selbstbestimmungsrechte sind hier nicht deshalb suspendiert, weil Menschen Adressat*innen sozialstaatlicher Leistungen sind. Adressat*innen dürfen demzufolge Angebote auch ablehnen, und zwar auch dann, wenn dies aus Sicht der Sozialfachkräfte nicht ›zielführend‹ ist. Ob etwas veränderungsbedürftig ist, wo genau der Bedarf liegt und wie er zu befriedigen ist, ist nach dem Dienstleistungsverständnis nicht der exklusiven Beurteilung der Fachkraft als ›Expertin‹ überlassen, sondern Gegenstand einer diskursiven Verständigung. Bei dieser geht es weder darum, Veränderungsbedürftigkeit unwidersprochen der Selbstdefinition der Betroffenen zu überlassen noch Veränderungsbedürftigkeit aus einer Haltung fachlicher Überlegenheit für nicht verhandelbar zu halten. Die Zustimmung der Adressat*innen zu einer gemeinsamen Definition von Hilfebedürftigkeit kann hierbei als »Kriterium für eine gelungene Kommunikation« (Hamburger 2016, S. 178) gelten. Diese kann aber nicht erzwungen werden. Am Ende ist es – zumindest vorläufig – hinzunehmen, dass Adressat*innen die Deutungsangebote der Sozialfachkraft und die damit korrespondierenden Hilfsangebote ablehnen (Müller 2015, S. 54) oder noch nicht annehmen können. Allerdings kann sich die Soziale Arbeit bei auftretenden Meinungsverschiedenheiten in bestimmten Fällen nicht aus der Interaktion mit ihren Adressat*innen zurückziehen (z. B. bei Personen, die wegen einer psychischen Behinderung nicht für sich selber sorgen können und deshalb in einem gesetzlichen Betreuungsverhältnis stehen, 
Kap. 1.4.2 1.4.2 Soziale Arbeit als soziale Kontrolle Bis hierin sind wir im Wesentlichen davon ausgegangen, dass die Kernaufgabe Sozialer Arbeit darin liegt, Menschen bei der Bewältigung belastender und überfordernder Lebenslagen zu unterstützen. Diese Hauptfunktion, das Hilfemandat, beruht auf Grundentscheidungen der Verfassung, die mit Begriffen wie Menschenwürde, freie Entfaltung der Persönlichkeit, dem Gleichheitsgebot und dem Sozialstaatsprinzip verbunden sind ( Kap. 5.1.2: Weitere Verfassungsprinzipien). Gegenstand der personenbezogenen Dienstleistungen sind aber nicht alleine individuelle, wie auch immer entstandene »Notlagen«, sondern auch – so bereits die Feststellung in Kapitel 1.3.2 – diverse Formen abweichenden Verhaltens (z. B. innerfamiliäre Gewalt). Abweichendes Verhalten ist zumeist kein Problem für die Person, die sich abweichend verhält, sondern ein Problem für ihre soziale Umgebung und die Gesellschaft insgesamt einschließlich ihrer Rechtsordnung. Wenn Sozialfachkräfte im Zusammenhang abweichenden Verhaltens tätig werden, geht es folglich nicht um ein Hilfebedürfnis der*des Einzelnen, sondern um das Interesse der Allgemeinheit, bestimmte Formen der individuellen Lebensführung nicht zu tolerieren. Die Tatsache, dass personenbezogene soziale Dienstleistungen einen zweifachen Adressaten haben (können), bezeichnet man als »Doppeltes Mandat« der Sozialen Arbeit (zuerst Böhnisch & Lösch 1973). Doppeltes Mandat bedeutet: Soziale Arbeit steht Menschen nicht nur bei, sie tritt ihnen auch als Repräsentantin der Gesellschaft gegenüber.
).
Читать дальше