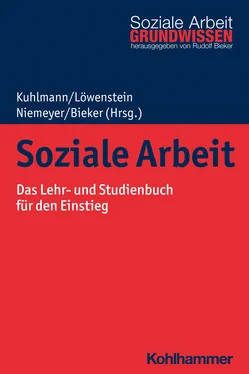Der Beitrag beginnt mit einer begrifflichen Einordnung Sozialer Arbeit als Dienstleistung und arbeitet heraus, was diese auszeichnet und von kommerziellen Dienstleistungen unterscheidet. Sodann geht es um den Gegenstand Sozialer Arbeit. Dieser ist eng mit der Bearbeitung Sozialer Probleme verbunden, die sich in Lebenslagen von Menschen ausdrücken. Danach werden wir die Frage »Was ist Soziale Arbeit?« anhand ihres gesellschaftlichen, in sich keineswegs spannungsfreien Auftrags (Mandat) weiterführen. Schlussendlich wird uns die Forderung beschäftigen, dieses Mandat um ein professionelles bzw. politisches Mandat zu erweitern.
1.1 Soziale Arbeit als personenbezogene soziale Dienstleistung
1.1.1 Begriffliche Klärungen
Aus volkswirtschaftlicher Sicht gehört die Soziale Arbeit zum Dienstleistungssektor. Dienstleistungen produzieren immaterielle Güter. Anders als einen Ziegelstein oder einen Stuhl kann man sie nicht anfassen, stapeln, vorproduzieren, lagern, vor Auslieferung einer Qualitätskontrolle unterwerfen und bei Untauglichkeit wieder zurückschicken (vgl. Badura & Groß 1976, S. 68).
Im Unterschied etwa zu handwerklichen Dienstleistungen werden Dienstleistungen der Sozialen Arbeit nicht auf einem Markt angeboten, der sich durch Angebot und Nachfrage mehr oder weniger selbst reguliert. Die Dienstleistungen der Sozialen Arbeit sind vielmehr staatlich reguliert und finanziert.
Zu sozialen Dienstleistungen werden Dienstleistungen dann, wenn sie als eigenständiges Element oder als integrierter Teil eines gesetzlich geregelten Leistungsversprechens gewährt werden.
»Mütter und Väter, die allein für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen, haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung« (§ 18 Abs. 1 SGB VIII).
Zu den sozialen Dienstleistungen im weiteren Sinne lassen sich auch solche Leistungen zählen, die aus einer sozialstaatsähnlichen Idee (Nächstenliebe, bürgerschaftliche Solidarität etc.) von nicht-staatlichen, aber gemeinnützigen Akteur*innen (Wohlfahrtsverbände, Stiftungen etc.) freiwillig angeboten werden. Diese Leistungen ergänzen das staatliche Programm. Weil sie im öffentlichen Interesse liegen, werden sie regelmäßig durch finanzielle Mittel des Staates (Bund, Länder, Kommunen) bezuschusst.
Professionell betreute Ferienprojekte für Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien; offene Angebote für ältere Menschen.
Soziale Dienstleistungen stellen eine Teilmenge personenbezogener Dienstleistungen dar (Dunkel 2011, S. 190).
Personenbezogene Dienstleistungen
Soziale Arbeit ist eine Dienstleistung, die sich unmittelbar auf die Person der Nutzer*innen und ihre Lebenslage richtet, einschließlich aller damit verbundenen Tätigkeiten (z. B. Erstellung von Diagnosen und Gutachten, vgl. Olk, Otto & Backhaus-Maul 2003, S. XII).
Adressat*innen personenbezogener Dienstleistungen können Individuen, Gruppen oder auch größere soziale Einheiten sein, wie z. B. die Bewohner*innen eines Stadtquartiers. Nicht alle personenbezogenen Dienstleistungen weisen aber ein Spezifikum auf, wie es für die Soziale Arbeit gilt. Die Besonderheit der Sozialen Arbeit liegt in der Notwendigkeit der aktiven Mitwirkung der Adressat*innen bei der ›Erstellung‹ der Dienstleistung Soziale Arbeit.
1.1.2 Besonderheiten der personenbezogenen Dienstleistung »Soziale Arbeit«
Aktive Mitwirkung der Adressat*innen
Wenn Menschen Dienstleistungen vom Typ der Sozialen Arbeit erhalten, geht es in der Regel um Veränderungen, die sich auf die existenziellen und sozialen Verhältnisse von Menschen beziehen, auf die Ressourcen, die ihnen zur Bewältigung des Lebens zur Verfügung stehen (z. B. Wissen, Problemlösungskompetenzen, Veränderungsmotivation) und/oder auf das soziale Verhalten von Menschen (z. B. Gewalt, Vernachlässigung der elterlichen Sorge). Veränderungen kommen hier durchweg nur zustande, wenn die Adressat*innen sich auf die Zusammenarbeit mit den Sozialfachkräften einlassen (Badura & Gross 1976, S. 68; Bieker 1989, S. 7). Eine Veränderung der Lebenslage oder von Verhaltensweisen ist nicht über den Kopf der Personen hinweg möglich. Im Unterschied zu personenbezogenen Dienstleistungen, die an Menschen vollzogen werden (z. B. Körperpflege, Haarschnitt, Maßnehmen der Schneiderin) kann Soziale Arbeit nur mit den ›Kund*innen‹ erbracht werden, nicht an ihnen. Es reicht hier nicht aus, dass sich Adressat*innen – ähnlich Patient*innen bei der Wundpflege im Altenheim – ruhig verhalten oder wie Kund*innen im Supermarkt das Scannen der ausgewählten Lebensmittel abwarten, damit die Dienstleistung erfolgreich abgeschlossen werden kann. In der Sozialen Arbeit geht es darum, Adressat*innen zur Offenheit für Veränderungen zu bewegen. Die Adressat*innen müssen die Leistungen grundsätzlich wollen, sich mit Widerständen und Ängsten vor Veränderungen auseinandersetzen, bisherige Verhaltensweisen hinterfragen, Informationen über sich preisgeben, Lösungen untereinander und gegen ein ›Weiter so‹ abwägen etc. Um eine Veränderung zu bewirken, ist jedenfalls die unbeteiligte Entgegennahme des Dienstleistungsangebots nicht aussichtsreich.
Die gelingende Kommunikation zwischen Sozialfachkräften und Adressat*innen ist die conditio sine qua non in der Sozialen Arbeit.
Für den Erfolg der Dienstleistung ist von erheblicher Bedeutung, ob es zu einem produktiven Arbeitsbündnis zwischen Sozialarbeiter*innen und Adressat*innen kommt, in dem sich die Adressat*innen akzeptiert fühlen, weder eine offene noch eine latente Entwertung als ›Lebensversager*innen‹, ›krank‹ oder ›unfähig‹ erfahren und weder bei der Problemdeutung noch bei der möglichen Problemlösung von den Sozialfachkräften übergangen werden. In einer respektvollen, auf grundsätzlicher Akzeptanz des Gegenübers als Person aufbauenden Gestaltung der Beziehung gilt es zu versuchen, Adressat*innen für notwendige Veränderungen aufzuschließen.
»Die erforderliche Akzeptanz ist nicht bloß ein passives Hinnehmen, sondern ein aktives Bejahen. Sie bezieht sich nicht auf einzelne Handlungen, die für gut oder schlecht, gut oder böse gehalten werden mögen, sondern besteht in der Annahme und Anerkennung des Anderen als Person in seiner prinzipiellen Fähigkeit und Berechtigung zur Selbstbestimmung. Mit personeller Selbstbestimmung ist nicht eine beliebige, zufällige Entscheidung für oder gegen etwas gemeint, sondern die Fähigkeit eines Subjekts, über seine grundlegenden Wertsetzungen zu entscheiden« (Schmid Noerr 2021, S. 71).
Da Veränderungen sich sowohl auf das soziale Verhalten von Menschen (Lebensführung) als auch auf ihre sozialen Lebensverhältnisse (materielle Lebenslage, soziale Integration) beziehen und beides in Wechselwirkung miteinander steht, lässt sich Soziale Arbeit begrifflich als ganzheitlich angelegte psychosoziale Dienstleistung einordnen. Psychosoziale Dienstleistungen setzen am Alltag von Menschen an. Es geht um dessen Bewältigung, um Entwicklungsförderung, Kompetenzentwicklung und Prävention (vgl. Wälte & Lübeck 2021, S. 26). Die Persönlichkeit der Adressat*innen ist in diese Veränderung immer involviert.
Soziale Arbeit als Ko-Produktion
Weil Soziale Arbeit nur mit, und nicht ohne oder gegen ihre Adressat*innen aussichtsreich ist, wird sie in der Fachliteratur als Ko-Produktion beschrieben. Sozialfachkräfte und Adressat*innen müssen im ›Produktionsprozess‹ erfolgreich zusammenwirken. Der Handlungserfolg im Sinne einer diskursiven Verständigung und der Umsetzung ihrer Ergebnisse in aktives Handeln entsteht in der Interaktion als das gemeinsame Ergebnis beider Akteur*innen. Sozialfachkräfte gelten hierbei in der Regel als die Produzent*innen, die Adressat*innen als Ko-Produzent*innen (Badura & Gross 1976, S. 69; Gartner & Riessman 1978, S. 21ff.).
Читать дальше