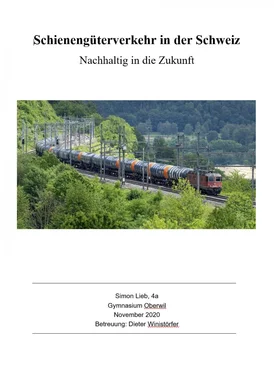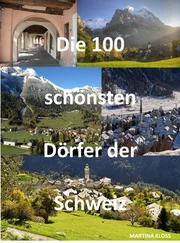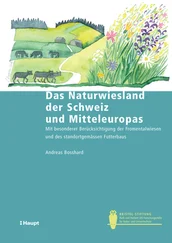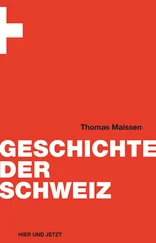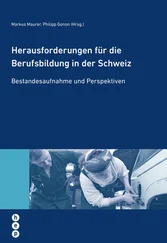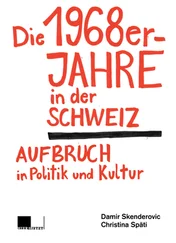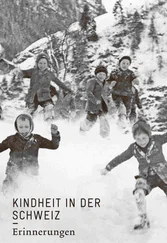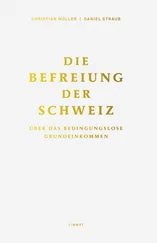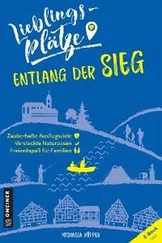Weiter wurde durch die Digitalisierung und das Aufkommen des flexiblen Lkws der Ausstieg aus der Lagerhaltung mit zunehmender Arbeitsteilung ermöglicht, was zudem eine Folge der Abnahme des Anteils der Transport- an den Produktionskosten war. Dies führte zu abnehmenden Sendungsgrössen, mehr Just-in-Time-Transporten, zur engeren Einbettung der Transporte in die Logistik der Kunden und zur Abnahme der für die Bahn sprechenden Bündelung. Aufgrund der gestiegenen Wertdichten und grösseren Abhängigkeit zwischen den einzelnen Produktionsschritten stiegen zudem die Kundenanforderungen betreffend Flexibilität, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit.
Einerseits mussten diese Entwicklungen zu Problemen und Anteilsrückgängen im SGV führen. Andererseits verpasste es die SBB aber, auf diese Veränderungen der Wirtschaftsstruktur zu reagieren, in neue Wachstumsmärkte einzusteigen (Konsumgüter) oder auf veränderte Kundenanforderungen zu reagieren. Zudem wurden wichtige Innovationen zur Steigerung der Produktivität wie der automatischen Kupplung nicht umgesetzt.
Ein Grund dafür war, dass der Güterverkehrsbereich der SBB gegenüber dem Personenverkehr (PV) vernachlässigt wurde. Peter Füglistaler beschreibt den SGV als «das etwas vernachlässigte Kind im ÖV». Und Philipp Hadorn meint, er sei «stiefmütterlich behandelt» worden, da er «innerhalb des SBB-Konzerns das Sorgenkind gewesen [ist], das nie auf einen grünen Zweig gekommen ist». Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass der SGV aufgrund des Aufkommens des Strassengüterverkehrs mit dem Autobahnbau zunehmend Verluste schrieb, an Gewicht verlor und entsprechend «als Last empfunden wurde». 46Zudem bekam er in der Politik wenig Aufmerksamkeit, da er kaum wahrgenommen wurde. So wurden wichtige Investitionen nicht getätigt und das steigende Angebot im PV hatte für den SGV qualitativ schlechtere Trassen zur Folge. Auch wurde der SGV in der Fläche beim Infrastrukturausbau, der ab den 1990er-Jahren mit Bahn 2000 wieder stärker vorangetrieben wurde, kaum berücksichtigt.
Zudem fehlte aufgrund der geringen Renditen Kapital, um in Innovationen zu investieren und somit den SGV zu verbessern. Man spricht auch von einem technologischen Patt und in Folge wurden wichtige technische Neuerungen nicht umgesetzt.
5.3.3 Das Verhältnis der Schweiz zur EU – Vom Alpenschutz zur Liberalisierung
Mit der Fertigstellung des Gotthardstrassentunnels im Jahr 1980 stieg der alpenquerende Strassengüterverkehr sprunghaft an und die negativen Folgen wie Lärm-, Stickoxid- und Feinstaubemissionen wurden vermehrt sichtbar. Auch nahm in dieser Zeit das Umweltbewusstsein zu. 1994 wurde der Alpenschutzartikel bei einer Volksabstimmung angenommen, mit dem Ziel den Strassentransitverkehr zu reduzieren (vgl. Kapitel 4.3.4). 47
Nach dem Nein zum EWR-Beitritt 1992 schloss die Schweiz mehrere Bilaterale Abkommen ab, darunter das für den GV wichtigen Landverkehrsabkommen. Darin ist festgehalten, dass die EU die Schweizer Verkehrspolitik mit LSVA akzeptiert, aber als Gegenleistung musste die Schweiz die Lkw-Gewichtslimite von 28 auf 40 Tonnen erhöht und die Abgabenlast begrenzen.
In den 1990er-Jahren wandelte sich das Schweizerische Eisenbahnsystem rapide. Mit der Bahnreform I wurde die SBB aus der Bundesverwaltung herausgelöst, in eine Aktiengesellschaft in vollständigem Besitz des Bundes überführt und entschuldet. 48Die SBB wurde in die Divisionen Personenverkehr, Infrastruktur und Güterverkehr aufgeteilt. Weiter wurde die Infrastruktur und der Verkehr voneinander getrennt, der diskriminierungsfreie Netzzugang 49eingeführt und zur Überwachung wurde eine unabhängige Schiedskommission eingesetzt. Zudem wurde der Güterverkehr liberalisiert. Das Hauptziel dieser Reformen war eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Bahnen gegenüber der Strasse. Dies sollte dank einer privatrechtlich ausgerichteten Marktorganisation für mehr unternehmerisches Denken, mehr Wettbewerb und international einheitliche Normen erreicht werden. Der wichtigste Grund für die Liberalisierung lag meiner Auffassung nach im Druck der EU zur Angleichung der Regelwerke sowie dem allgemeinen Liberalisierungstrend 50. Alle befragten Interviewpartner sehen die Bahnreform als positiv oder sogar notwendig an, da vorhin massive Probleme bestanden hätten.
5.4 Das 21. Jahrhundert – Das neue Jahrtausend 51
5.4.1 Folgen der Liberalisierung auf den SGV
Die Bahnreform I im Jahr 1999, insbesondere die Liberalisierung des SGVs und die Öffnung des Netzzugangs, hat den SGV in der Fläche grundlegend verändert. Bis anhin waren die SBB als nationale Staatsbahn sowie zahlreiche mehrheitlich in Kantonsbesitz befindliche Privatbahnen auf ihrem jeweiligen Netz Monopolisten. Aufgrund des Territorialprinzips 52waren viele dieser Bahnen auch im SGV in der Fläche tätig und führten diesen gemeinsam durch. Die Einnahmen gingen aber nicht an die Bahn, die den Transport durchführte, sondern an die Bahn, auf deren Infrastruktur er stattfand, was zu Marktverzerrungen führte.
Mit der Bahnreform änderte sich dies und jedes EVU konnte auf dem Netz der anderen fahren. Da es effizienter ist, wenn das EWLV-Netz von nur einem Anbieter betrieben wird, übernahm die SBB Cargo auf dem gesamten Normalspurnetz die Transportaufgaben im EWLV.
Gleichzeitig nahmen aber mehrere Privatbahnen, insbesondere die BLS, einfach zu produzierende Ganzzugsverkehre als Nischenanbieter auf. Es wurden gewissermassen die profitablen Rosinen herausgepickt, was eine logische Konsequenz der Marktöffnung war. Durch diese Konkurrenzierung wurden die Gewinne im zuvor relativ profitablen Ganzzugverkehr der SBB, die den EWLV stützten, stark gedrückt, was deren finanziell bereits schwierige Lage weiter anspannte. Zudem wurden grössere ehemals im EWLV transportierte Güter durch Wettbewerber herausgenommen und neu als Ganzzugsverkehre gefahren, was dessen Auslastung senkte. In Folge gab es kaum Spielraum für Investitionen. Auf der anderen Seite führt Liberalisierung grundsätzlich zum Druck, sich von der Konkurrenz abzuheben und besser zu werden. Es ist meiner Meinung nach schwierig abzuschätzen, ob die Liberalisierung eher zu Leistungsabbau führte, oder damit unternehmerisches Denken, eine erhöhte Kundenorientierung sowie Innovationstätigkeit folgte und damit ein noch stärkerer Rückgang verhindert wurde (für eine genauere Analyse vgl. Kapitel 0).
5.4.2 Güterverkehrspolitik in der Fläche
Nach der Liberalisierung und den Bilateralen Abkommen mit der EU wurden bis 2008 die Trassenpreissubventionen vollständig abgebaut. Dies führte einerseits zum Druck, die Effizienz zu steigern, andererseits wurden meiner Meinung nach die finanziellen Probleme verschärft.
Zudem bestand eine unklare Zielsetzung zwischen Eigenwirtschaftlichkeit und Flächenbedienung und eine Vielzahl an unterschiedlichen Förderungen. Um dies zu klären, den SGV entsprechend gezielt zu fördern und die bestehenden Probleme zu lösen, wurde das GüTG zwischen 2011 und 2016 totalrevidiert (vgl. Kapitel 4.3.2). In Folge wurde die Subventionierung auf die Förderung der Infrastruktur wie Anschlussgleisen ausgerichtet, während die Betriebsabgeltungen im Umfang von etwa 30 Mio. Franken vollständig abgebaut wurden mit dem primären Ziel der Eigenwirtschaftlichkeit der SBB Cargo. Zudem wurde es neu möglich, Innovationen zu fördern. Auch wurde die lange geltende Priorisierung des Personenverkehrs bei der Trassenvergabe gestrichen.
Schliesslich hat sich 2020 die Swiss Combi, bestehend aus vier Schweizer Strassenverkehrsunternehmen, mit 35% an der SBB Cargo beteiligt. Dies mit dem Ziel, privates Risikokapital in das Unternehmen zu bringen, die Kundenorientierung zu erhöhen, mehr Mengen ins EWLV-System zu bringen und die SBB Cargo unternehmerischer auszurichten.
Читать дальше