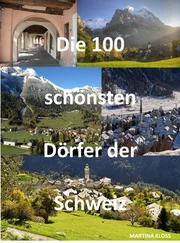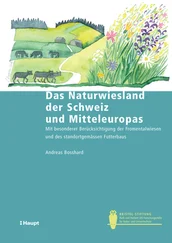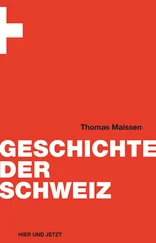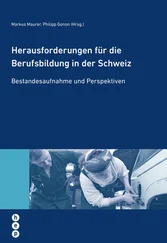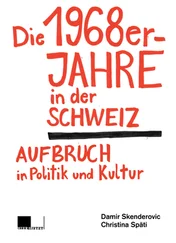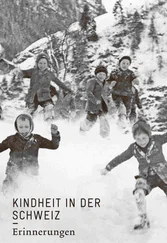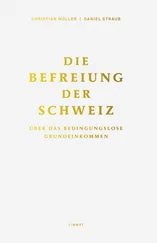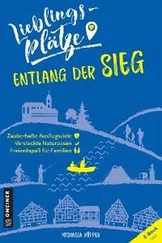Zu diesem Zeitpunkt ist der Bau des Eisenbahnnetzes, wie es auch heute noch besteht, Grossteils abgeschlossen. Bis 1913 folgt nur noch die Lötschberg-Simplon-Strecke. Neben dem Eisenbahnnetz existiert ein ausgebautes Poststrassennetz, welches die Feinverteilung der Güter an von Bahnstrecken abgelegene Orte übernimmt. Die dafür zuständige Post setzt Pferdefuhrwerke ein, die ihren Höhepunkt erst im 2. Weltkrieg erreichen.
Die in diesem Jahrhundert entstandene Eisenbahn hat die Schweizer Siedlungsstruktur bis heute wesentlich geprägt. Auch konnte sich die Industrialisierung erst durch die Eisenbahn in diesem Umfang vollziehen, da die Güter um ein Vielfaches billiger, in grossen Mengen und stark beschleunigt transportiert werden konnten.
5.1.2 Schienengüterverkehr zu den Anfängen der Eisenbahn
Der Güterverkehr war in den ersten 120 Jahren der Schweizer Eisenbahnen der dominierende Verkehr und generierte die meisten Einnahmen. So gab es vor dem ersten Weltkrieg 20`000 Güterwagen gegenüber 5`000 Personenwagen. Zudem wurden Industrie und Landwirtschaft zulasten des Personenverkehrs begünstigt. Zu Beginn dominierten Stückgutverkehre, die in Packwagen an Personenzüge angehängt wurden oder als separate Güterzüge wie im Personenverkehr an allen Bahnhöfen hielten. Weiter wurden Eilgutverkehre und für grössere Sendungen Wagenladungsverkehre betrieben. Die Organisation erfolgte dabei über Briefe und auch der Betrieb war sehr personalintensiv. Als Kupplung hatte sich europaweit ein System mit Schraubenkupplungen durchgesetzt, während in Amerika bereits vor 1900 eine viel einfacher zu handhabende automatische Kupplung eingeführt wurde.
5.2 Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts – Geprägt durch zwei Weltkriege
Mit der Verstaatlichung und Zusammenführung der fünf grössten Privatbahnkonzerne zur neuen Schweizerischen Bundesbahn wurde zwar die ruinöse Konkurrenz beendet, doch waren die Probleme keineswegs gelöst. 40Denn die neue SBB erbte alle Schulden und Verpflichtungen gegenüber privaten Kapitalgebern sowie die veraltete Infrastruktur und das uneinheitliche Rollmaterial. Zudem bestanden politisch bedingt nicht kostendeckende Tarife. Die SBB musste nun nur aus ihren Einnahmen neben den Betriebskosten auch alle Schuldzinsen und Erneuerungsinvestitionen zahlen. In Folge wuchs der Schuldenberg in den ersten 40 Jahren stark an.
Im ersten Weltkrieg zeigt sich erstmals die Abhängigkeit der Schweiz von teuren Kohleimporten. Um diese zu verringern, startet die Schweiz 1916 ein weltweit beispielloses Elektrifizierungsprogramm des Bahnnetzes. Bis 1928 wurden alle Hauptbahnen und bis 1960 praktisch das gesamte Bahnnetz elektrifiziert. Die umfangreichen Investitionen der SBB in die Elektrifizierung bewirkten eine starke Subventionierung und Umstrukturierung der Industrie.
Aufgrund der hohen Investitionen erhöhten sich die bereits angehäuften Schulden weiter. Die resultierenden hohen Kapitalkosten im Umfang von 30% der Jahreseinnahmen führten zu einer sinkenden Eigenwirtschaftlichkeit der SBB, sodass sie nach dem zweiten Weltkrieg saniert und entschuldet werden musste. Trotzdem hatte sie weiterhin hohe Schulden, was die nach dem zweiten Weltkrieg durch die Konkurrenz der Strasse entstehenden Probleme weiter verschärfte. Zudem wird 1935 mit dem Verkehrsteilungsgesetz eine Gesamtverkehrskoordination abgelehnt, welche verlangt hätte, den Güterfernverkehr vorab auf der Schiene durchzuführen, um eine ruinöse Konkurrenzierung zu verhindern.
Auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts blieb der Güterverkehr Haupteinnahmequelle der Eisenbahnen. Der WLV und Stückgutverkehr befanden sich in ihrer Blütezeit und nahmen stark zu. Um den SGV zu beschleunigen, wurde der Fernverkehr vom Stückgutverkehr getrennt, sodass dessen Wagen nicht mehr an jeder Haltestelle anhalten mussten. Zudem wurde 1926 der Nachtdienst eingeführt und 1933 der Rangierbahnhof in Muttenz eröffnet. Hingegen blieb der Aufbau der Güterwagen weitgehend konservativ und nur wenige Neuerungen fanden Einzug.
5.3 Die zweite Hälfte des 20. Jh. - Konkurrenz durch die Strasse 41
5.3.1 Ausbau der Strasseninfrastruktur
 Abbildung 14: Die parallel zur Eisenbahnstrecke verlaufende Gotthard-Autobahn 42 Abbildung 14: Die parallel zur Eisenbahnstrecke verlaufende Gotthard-Autobahn 42 |
Die Zeit zwischen dem zweiten Weltkrieg und der Jahrtausendwende war wesentlich von der Umwälzung des Verkehrssystems durch den Strassenverkehr geprägt. Der starke Ausbau des Strassennetzes zog einen starken Anstieg des Strassengüterverkehrs nach sich. Zum einen wurde das feinmaschige Gemeindestrassennetz für den motorisierten Verkehr verstärkt und verbreitert, zum anderen wurde das Kantons- und Nationalstrassennetz stark ausgebaut. Nach dem in einer Volksabstimmung angenommenen Treibstoffzollzuschlag begann der Bund in den 1960er-Jahren mit dem Bau eines schweizweiten, engmaschigen und parallel zum Schienennetz verlaufenden Autobahnnetzes (vgl. Abbildung 14). In den folgenden drei Jahrzehnten waren die Investitionen in den Strassenbau fünf- bis siebenmal höher als in die Schieneninfrastruktur. Erst vor der Jahrtausendwende wurde der Ausbau der Eisenbahninfrastruktur mit Bahn 2000 wieder forciert. Und während der Strassenverkehr durch den grossflächigen Ausbau eines leistungsfähigen Strassennetzes gefördert wurde, wurden die Kosten der negativen Auswirkungen auf die Allgemeinheit abgewälzt (vgl. Kapitel 6).
5.3.2 Höhepunkt und Abbau im Schienengüterverkehr
Trotz der zunehmenden Konkurrenz durch den Strassengüterverkehr erreichte der WLV in den 1970er-Jahren seinen Höhepunkt, insbesondere, da die Schweiz den zweiten Weltkrieg fast unbeschadet überstand und die intakte Industrie vom Aufschwung profitieren konnte. So hatte die Schweiz bis in die 1960er-Jahre den höchsten Industrialisierungsgrad aller Länder. Auch ermöglichte das vollständig elektrifizierte Eisenbahnnetz, der Einsatz von abgeschriebenem Rollmaterial und Personenzügen mit Güterbeförderung ein attraktives Angebot zu geringen Betriebskosten. Die Erhaltung der hohen Dichte des Bahnnetzes in der Schweiz 43ist vor allem diesen Aspekten und der Subventionierung von Nebenbahnen zu verdanken. Zu dieser Zeit gab es 1`918 Güterbahnhöfe in der Schweiz und 2/3 aller Eisenbahnwagen waren Güterwagen.
Doch seit den 1970er-Jahren wurde der SGV zunehmend unrentabel. In Folge wurden viele Güterbahnhöfe und Anschlussgleise geschlossen und die Angebote des EWLVs und Stückgutverkehrs abgebaut. Während der Strassengüterverkehr in der Fläche von 1950 bis 2000 um das 13-fache zunahm, stieg die Verkehrsleistung des SGVs in der Fläche nur um das Dreifache an. 44Meiner Analyse nach sind dafür mehrere Ursachen verantwortlich. 45Erstens kam der Güterverkehr durch die Konkurrenz des Strassengüterverkehrs mit dem Autobahnbau zunehmend in Bedrängnis. Ein Lkw war flexibler und hatte aufgrund der schwächeren Arbeits- und Sicherheitsauflagen einen Konkurrenzvorteil. Zusätzlich wandelte sich auch die Raumstruktur zu Ungunsten des SGVs, da es den Unternehmen durch den Lkw zunehmend möglich wurde, auch abseits des Schienennetzes Standorte aufzubauen.
Neben der Konkurrenzierung kam hinzu, dass durch die Deregulierung des internationalen Güteraustausches zunehmend globalisierte Wertschöpfungsketten entstanden und grosse Teile der Industrieproduktion ins Ausland verlagert wurden. In Folge der Deindustrialisierung mussten weniger bahnaffine Güter, die durch regelmässige Transporte in grossen Mengen gekennzeichnet sind, transportiert werden. Hingegen erhöhte sich der Anteil kleiner, leichter und hochwertiger Konsumgüter. Dieser Trend zu kleineren Sendungsgrössen mit höherwertigen Gütern wird als Güterstruktureffekt bezeichnet.
Читать дальше
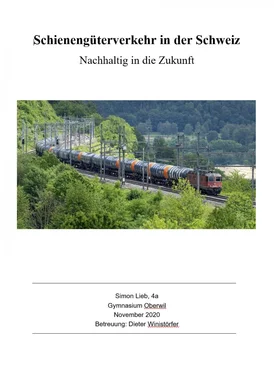
 Abbildung 14: Die parallel zur Eisenbahnstrecke verlaufende Gotthard-Autobahn 42
Abbildung 14: Die parallel zur Eisenbahnstrecke verlaufende Gotthard-Autobahn 42