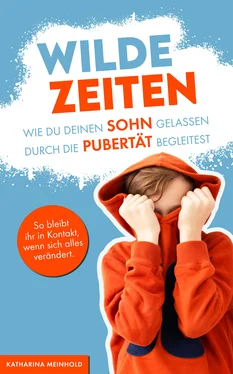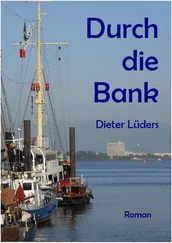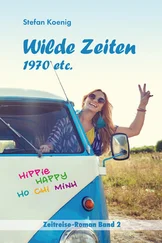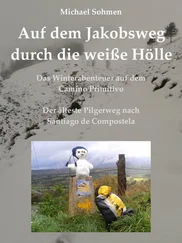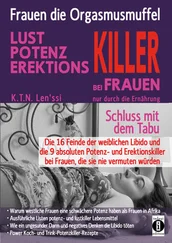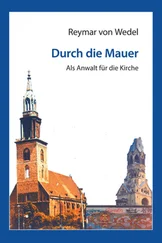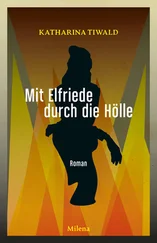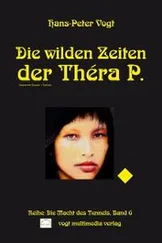Dieses Buch bietet einen Überblick über die wichtigsten Fragen der Pubertät bei Jungen und hilft mit praktischen Tipps und kleinen Übungen, die neue Situation besser zu verstehen und Lösungswege für den individuellen Gebrauch zu finden. So findet ihr euch im Dschungel der Pubertät mit eurem Sohn besser zurecht und könnt euch vielleicht sogar auf die wilden Jahre freuen, wie auf ein großes neues Abenteuer.
Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsneutrale Unterscheidung verzichtet. Bei personenbezogenen Hauptwörtern sind selbstverständlich stets alle Geschlechter angesprochen.
Ängste der Eltern vor der Pubertät
Um die Pubertät wird viel gestritten: Sie gilt als eine Phase der Herausforderung auf allen Gebieten. Seit der Antike wird vor allem vor jungen Männern gewarnt, wird die Phase des Übergangs problematisiert. Eine Herausforderung ist sie zweifellos: vor allem für euren Jungen selbst, denn neben einem Wachstumsschub steht ein kompletter Umbau des Gehirns an.
Doch solltet ihr als Eltern nicht vorab in Panik verfallen, sondern Ruhe bewahren und eure individuelle Situation verantwortungsbewusst im Auge behalten. Vertraut auch auf das, was ihr bisher als Eltern geleistet habt, denn auch die Rahmenbedingungen zählen in dieser ereignisreichen Phase.
Erwartungen, Herausforderungen und Realität
In einer immer komplizierter werdenden Zeit erleben sich Eltern oft als überfordert. Sie stehen zwischen allen Fronten: Der Druck der Schule, die Angst vor der Zukunft, die täglich zunehmende Unsicherheit der eigenen Verhältnisse belasten sie, ihre Beziehung, das Verhältnis in der Familie. Diese Ängste übertragen sich auf die Kinder.
Die Pubertät wird dabei nicht selten zur Projektionsfläche. An sich ist sie keine Katastrophe. Es handelt sich um eine Übergangsphase, in der aus dem Mädchen eine Frau, aus dem Jungen ein Mann wird. Dabei spielen physiologische und psychologische Umbau- und Reifungsprozesse, die sich in einem bestimmten zeitlichen Rahmen vollziehen, eine Rolle. Wer in einem positiven Umfeld aufwächst und starke Erwachsene um sich hat, die gerne Mann und Frau sind und sich erfolgreich Herausforderungen stellen, der wird auch gerne teilhaben wollen und sich in dieser Phase auf das Erwachsenwerden vorbereiten. Wer in Verunsicherung lebt, wird es schwerer haben.
Doch letztlich ist die Pubertät immer ein individueller Prozess. Eltern mit mehreren Kindern kennen das bereits: Ein Kind pubertiert stark, während andere die Phase beinahe problemlos überstehen. Bei einem ist es kaum auszumachen, wann die Pubertät stattgefunden hat, bei anderen dehnt sich der Prozess über Jahre hinweg. Das Erwachsenwerden erscheint ihnen wenig attraktiv. Physische Wandlung und psychische driften auseinander.
Gerade Jungen werden schnell zur Zielscheibe von Vorurteilen. Sie gelten rasch als Rabauken, Unruhestifter, Schulversager. Diese Zuschreibungen haben nicht selten Folgen und ein Junge verhält sich exakt so oder zieht sich tief verletzt zurück. Das kann bis zur Depression gehen oder sich in Suchtverhalten äußern. Wichtig ist es, sich als Erwachsener angstfrei und ohne Vorurteile auf die eigene, spezifische Situation in der Familie einzustellen und so dem Sohn die Möglichkeit zu geben, seine Pubertät zu durchleben.
Die eigene Geschichte
Während des Zusammenlebens mit eurem Sohn sind euch sicher bereits zwei Dinge aufgefallen: 1. Nichts geht unbedingt nach Lehrbuch und 2. die eigenen Prägungen haben einen großen Einfluss auf unser Verhalten dem Kind gegenüber. Unsere eigene Geschichte bestimmt unsere Beziehungen in vielfältiger Weise. Sie hat Einfluss auf unsere Kommunikation, unsere Art zu streiten, Freude zu zeigen, Kritik und Liebe zu äußern. Sie hat auch immensen Einfluss auf unser Geschlechterbild und die Erwartungen, die wir an einen Heranwachsenden stellen.
Wer sich bereits intensiv mit sich selbst befasst hat, die eigenen Stärken und Schwächen kennt, wer mit seinem Partner im Austausch steht, der reflektiert und korrigiert sein Verhalten, ohne an Authentizität zu verlieren. Er ist sich bewusst, dass die eigene Wahrnehmung nur eine durch seine eigene Geschichte geprägte Sicht ist. Hat dieser Prozess der Achtsamkeit sich selbst gegenüber bereits vor der Pubertät des eigenen Kindes eingesetzt, wird Verletzungen und Missverständnissen vorgebaut. Der Erwachsene kann dann souveräner mit der Situation umgehen und sich verantwortungsbewusst verhalten.
Stammen beide Elternteile selbst aus einem sicheren, liebevollen Familienumfeld, haben sie es deutlich leichter. Sie wissen intuitiv, wie man mit Herausforderungen und Streit umgeht. War das eigene Heranwachsen jedoch belastet, können sich diese Belastungen wiederum einstellen. Das ist keine magische Wiederholung, sondern einfach das Agieren in den erlernten Parametern (Vorgaben). Hat eine Mutter unter einem sehr dominanten oder sogar jähzornigen Vater gelitten, kann es sein, dass sie selbst aufbrausend reagiert oder Verhaltensweisen, die einen solchen Ausbruch bei ihrem Sohn auslösen könnten, vermeidet. Dem Jungen fehlt damit ein ausgeglichenes Gegenüber. Er wird nun seinerseits entweder aufbrausend oder geduckt reagieren. Die erwachsene Orientierungsperspektive fehlt.
Durch eine intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich können die individuelle Entwicklungsgeschichte begriffen und das eigene Verhalten korrigiert werden. Übermäßige Ängste, Aggressionen oder Ausweichhaltungen lassen sich dann rechtzeitig korrigieren.
Kommunikation in der Familie
Die eigenen Kindheitserfahrungen haben uns geprägt. Sie äußern sich vor allem auch in unserer Kommunikation. Was wir sagen und wie wir etwas verstehen, hängt auch davon ab, was wir sagen und wie wir etwas verstehen wollen. Wir hören und verstehen durch Filter. Dadurch kommt es immer wieder zu Missverständnissen. Diese treten allgemein im Leben, in der Paarbeziehung und in dem Verhältnis der Eltern zu ihrem Sohn auf.
Bemüht man sich in der Familie um eine liebevolle, zugewandte Atmosphäre, ist gewaltfreie Kommunikation (nach Marshall B. Rosenberg) ein Handlungskonzept, das über den rein verbalen Bereich hinausgeht und die Bindung in der Familie stärkt. Während Tadel, Zurechtweisungen und Beschimpfungen demütigen, Widerspruch hervorrufen oder nachhaltige Schäden hinterlassen, ermöglicht gewaltfreie Kommunikation Entwicklung, Öffnung und das sachliche Lösen von Konflikten, ohne dass Familienmitgliedern die Rolle von Gewinnern oder Verlierern zugewiesen wird.
Dabei sollte man jedoch nicht in pseudo-positive Setzungen verfallen. Eine nur scheinbar gewaltfreie Sprache, die zwar Beschimpfungen und Zuweisungen vermeidet, jedoch Verachtung und Zurechtweisung transportiert, wird von Jugendlichen schnell entlarvt und beschädigt das Vertrauen langfristig. Ärger lässt sich als Ärger äußern, wenn deutliche Ich-Botschaften gesandt werden. Damit zeigen wir, dass wir ein Problem haben und geben anderen die Möglichkeit, uns zu unterstützen und eine Lösung zu finden. Bei einer Du-Botschaft schieben wir dem anderen das Problem zu, identifizieren ihn vollkommen damit und lassen ihn mit der Herausforderung allein. Statt auf eine Problemlösung fokussieren wir auf eine Schuldzuweisung und bringen das Kind zwangsweise in die Situation, sich wegzuducken oder sich zu verteidigen. Ziel sollten immer ein lösungsorientiertes Handeln und ein respektvoller Umgang miteinander sein. Lebt ein Paar diese Art der Kommunikation vor, übernehmen Kinder die gewaltfreie Art zu kommunizieren und sind auch während der Pubertät mit den Kriterien einer achtungsvollen Auseinandersetzung vertraut.
Menschliche Beziehungen verändern sich. Sie sind nicht statisch verankert, sondern in Bewegung. In der Familie sollten diese Veränderungen auf Basis der Verbindlichkeit Raum zur freien Entfaltung bekommen. Verbindlich bleibt die Beziehung als Familie, die sich liebe- und vertrauensvoll zugewandt ist. Dennoch können sich auch die Beziehungen innerhalb der Familie wandeln.
Читать дальше