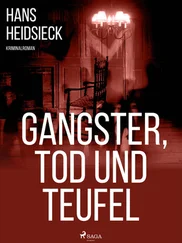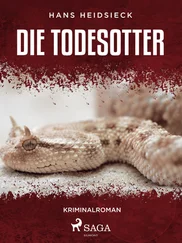Seit Tagen wanderten sie an einem großen Fluss entlang. Ansiedlungen von Menschen umgingen sie weiträumig, vermieden Begegnungen und Gespräche mit fremden Menschen. Die Schwänin wurde immer schwächer, nur noch kurze Wegstrecken bewältigte sie. Sie war verstummt, lebte in ihrer eigenen Welt. Von der Umgebung und selbst von ihrem geliebten Sohn nahm sie kaum mehr Notiz. Sie ließ sich von ihm führen und tat widerspruchslos alles, was er von ihr verlangte. Müden Schrittes schleppte sie sich voran. Sie aß nicht mehr, selten trank sie noch etwas Wasser.
Eines Morgens stand sie nicht mehr auf. Abgezehrt bis auf die Knochen konnte sie nicht mehr, und sie wollte auch nicht mehr. „Was soll ich nur machen mit Dir?“ klagte Gilger. „Du hast mich vor dem Tod in unserem Dorf gerettet, und nun willst Du hier sterben. Wozu das alles?“
„Ich werde nicht wirklich sterben. Ich fliege zu den Göttern. Der weiße Schwan wird sich um mich kümmern.“ Sie deutete mit schwacher Hand zum Himmel. „Dort oben werde ich weiter leben, von da aus werde ich auf Dich aufpassen. Lass mich hier liegen, hier ist ein schöner Platz. Ich kann einen See sehen, auf dem viele weiße Schwäne schwimmen. Kannst Du sie nicht sehen?“
Die ganze Zeit war Gilger neben seiner Mutter gesessen, innerlich hatte er sich wie ausgetrocknet gefühlt. Vor lauter Müdigkeit musste er eingeschlafen sein – als eine Berührung ihn plötzlich aufschreckte. Er hatte im Schlaf die Hand ausgestreckt und den kalten Körper seiner Mutter berührt, ihm war als würde ein Messer mitten in seine Brust gestochen. Unfähig sich zu rühren, blieb er lange neben seiner toten Mutter liegen. Erst spät stahl sich eine Träne aus seinem Auge, dann aber setzte eine ganze Tränenflut ein.
Gilger war jetzt alleine. In ihr Dorf konnte er nicht zurückkehren. Und auch nicht in andere Siedlungen der Aschkanen. Die würden ihn in sein altes Dorf bringen, wo ihn der sichere Tod erwartete. Jetzt erst recht, nachdem sie geflüchtet waren und es so aussah, als habe er in der Tat auf Maluga mit einem Pfeil geschossen und sie fast umgebracht.
Eine große Leichenfeier konnte er für seine Mutter nicht organisieren, niemand würde zu ihrem Begräbnis kommen. Schweren Herzens hob er eine Grube aus und legte die Schwänin hinein, ganz vorsichtig, als wolle er ihr nicht wehtun. Er färbte ihr Gesicht und die Hände mit Okra, der gelben Erde, die sie in einem Säckchen die ganze Flucht über mit sich geschleppt hatte. Gilger zog ihr Schuhe und Mütze an und legte ihr den schönen Fellumhang um.
Noch fehlt etwas, dachte er bei sich. Daheim hätte sie noch allerhand andere Dinge mit ins Grab bekommen, insbesondere Sachen, die sie als Mittlerin oft benützt hatte. Nicht weit entfernt lagen ein paar schöne weiße Federn, ihm dünkte, als ob sich ihr anderes Ich dazu gesellen wollte. Daneben lag ein wunderschöner Stein mit schwarzer Maserung. Als er ihn in die Hand nahm, veränderte er seine Farbe, von einem matten grau über gelbgrün bis tiefgrün.
Einen so schönen lebendig erscheinenden Stein hatte Gilger noch nie gesehen. Das war zweifellos ein Zeichen der Götter, dass sie die Schwänin bei sich aufnehmen wollten. Dankbar nahm Gilger den Stein und legte ihn auf die Brust seiner Mutter. Damm bedeckte er den Leichnam mit frischen Gräsern und schaufelte mit beiden Händen das Grab zu. Auf die Erde steckte er weiße Schwanenfedern, mit denen er einen Kreis als Symbol für die Unendlichkeit bildete.
Gilger trauerte noch drei Tage am Grab seiner Mutter. Dann erst raffte er sich schweren Herzens auf, um seinen eigenen Weg zu suchen. Er wanderte weiter dem großen Fluss entlang, bog in ein hübsches Seitental ein, wo er einem munter rauschenden Flüsschen bergwärts folgte. Aus der Ferne beobachtete er ein paar Mädchen, die volle Körbe mit leckeren Beeren nach Hause trugen. Er folgte ihnen, ohne sich ihnen zu zeigen. Ihm schien es sicherer, abzuwarten und weitere Erkundungen zu machen. Die Menschen in der nahe gelegenen Siedlung schienen friedlich zu sein, nachts hörte er sie von Weitem singen.
Am nächsten Morgen verließen die Mädchen erneut ihr Dorf. Wieder hatten sie ihre Körbe dabei. Gilgers Herz klopfte bis zum Hals. Er musste seinen ganzen Mut zusammennehmen, um auf die Mädchen zuzugehen und sie anzusprechen. Stotternd erzählte er, dass er von weit her komme, seit vielen Tagen schon unterwegs sei. Er wolle sich die Welt anschauen, Neues erkunden.
„Dann komm doch einfach mit uns“, sagten die Mädchen. „In der Zwischenzeit kannst Du uns ja beim Beerensammeln helfen“, antworteten sie kichernd. Mit vollen Körben kehrten sie gegen Nachmittag ins Dorf zurück, vorbei an großen abgeernteten Getreidefeldern. Dabei fiel ihm auf, dass eine von ihnen einen schönen grün schimmernden Schmuck an ihrem Halsband trug. Einen Stein, wie er ihn erst vor Kurzem gefunden und seiner Mutter ins Grab gelegt hatte.
Im Dorf wurde kein großes Aufheben um den Neuankömmling gemacht. Offenbar waren die Dorfbewohner an Fremde gewöhnt. „Suchst Du auch Arbeit in der Mine?“ wurde er mehrfach gefragt. Wobei Gilger dann jedes Mal ein unbestimmtes „Ja“ brummte. Denn er wusste nicht, was darunter zu verstehen ist, wollte seine Unwissenheit aber nicht zugeben. Ihn erstaunten die riesigen Felder, die in keinem Verhältnis zur Größe des Dorfes standen. So viel konnten die Menschen hier auf keinen Fall selbst verzehren.
In sein Auge stachen die hübschen Mädchen und Frauen, von denen sich einige mit den schönen grünen Steinen geschmückt hatten. Andererseits sah er nur wenige Männer. Er fragte das Mädchen, das er als erstes mit dem grün schimmernden Halsschmuck gesehen hatte, nach der Herkunft dieser schimmernden Schmuckstücke.
„Sie sind alle von der Mine. Unsere Männer bringen sie manchmal mit; wenn sie uns eine besondere Freude machen wollen“.
„Oder wenn sie eine ganz besondere Freude von uns erwarten…“ kicherte ihre Freundin. „Hast Du denn keinen mitgebracht?“ fragte sie ihn, in dem sie ihn schelmisch ansah und dabei leicht mit ihren Hüften kreiste. „Die Mine, wo ist denn die?“ stammelte Gilger, dem plötzlich die Röte ins Gesicht stieg.
Am Morgen nach dem Fest regnete es in Strömen, heftige Windböen schlugen Äste und Zweige umher, ein kalter Wind pfiff in Öcetims Lager und weckte ihn unsanft. Öcetim kauerte sich eng in seinen Umhang, am liebsten wäre er bei dem scheußlichen Wetter liegen geblieben; zumal sein Schädel brummte und ihm nicht wohl war. Doch er hatte sich mit Celso verabredet – und mit dem Kahlköpfigen schien nicht zu spaßen zu sein. Schon früh am Morgen wollten sie aufbrechen. Celso, er und noch ein paar Jungen in seinem Alter, hatte Celso gesagt. Missgelaunt und nur notdürftig gewaschen zog er über seine Felljacke einen aus Schilfgras selbst gefertigten Umhang, der ihn gegen Wind und Regen schützte.
Mit geringer Verspätung kam Öcetim zum ausgemachten Treffpunkt. Verlassen lag die Siedlung da, kein Mensch war zu sehen, nur aus den Hütten quoll Rauch, die Leute zogen es offensichtlich vor, ihren Rausch auszuschlafen. Öcetim überlegte, ob er nicht zurück zu seinem Lagerplatz gehen sollte. Sollte er wirklich tagelang in solch einem Regen marschieren, sich durch den Matsch quälen, um zu einer Mine zu gelangen, wo ihn eine ungewisse Zukunft erwartete? Was ihm noch vor wenigen Tagen verlockend erschien, ängstigte ihn nun zunehmend. Ihm schien, als wolle ihm der Regengott ein Zeichen geben, dass er nicht zu den Minen gehen solle - zumindest jetzt noch nicht.
Von Zweifeln geplagt wollte Öcetim schon dem Wink des Wettergottes folgen und seine Schritte zurück zu seinem einfachen Lager wenden, als Celso mit zwei jungen Männern um die Ecke bog. „Einer ist wohl abgehauen, ein Hasenfuß, der die neue Welt nicht erleben will. Den Feigling werde ich mir bei nächster Gelegenheit vorknöpfen, zumal er mir noch zwei Hände voll Rad schuldet“, brummte Celso mit drohendem Unterton, während seine Hände einem imaginären Burschen den Hals umzudrehen schienen. „Wir gehen. Der Hinkende dort ist Gilger und der dort heißt Hirgelo, der Andere nennt sich Öcetim, und wenn einer umkehren will, dann schlag ich ihm den Schädel ein! Jetzt aber los! Dass mir ja keiner schlapp macht, in der Mine werdet ihr schon erwartet.“
Читать дальше