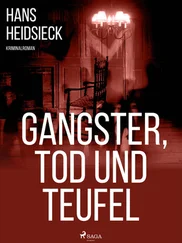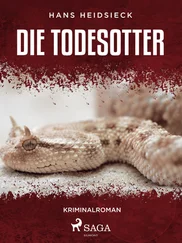1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 Da schien Golgor aus seiner Trance zu erwachen, mit einem Stock stieß er ein Loch in den Ofen, eine schwarze Flüssigkeit quoll heraus. Der Meister nickte zufrieden und wies Hirgelo an, die heißen Ofensteine abzutragen. Er erklärte ihm, dass er zuvor nassen Lehm dick auf seine Hände und Unterarme auftragen solle, um sie gegen die enorme Hitze zu schützen und sich keine Brandverletzungen zuzuziehen.
Stück für Stück kam nun schwarze Schlacke zum Vorschein, die Hirgelo wegzuwerfen hatte, da sie kein Kupfer enthielt. Unten, am Boden des Ofens, lag ein schwarzer Kuchen, an manchen Stellen schimmerte er rot wie Lachs. „Das ist es“, sprach der Meister ehrfurchtsvoll, dabei jedes Wort betonend: „Hier steckt das drin, weshalb sich alle hier so plagen. Kupfer! Woraus sich die schönsten und wertvollsten Dinge machen lassen, die ein Mensch je gesehen hat.“
Die Arbeit in der Mine war hart und sie wurde zunehmend eintönig. „Manche Leute sind an den Öfen eingesetzt und manche arbeiten in den Stollen im Berg drinnen“, sagte eines Tages Öcetim zu Hirgelo und Gilger. „Wir klopfen uns mit unseren Steinschlägel hier draußen bucklig, fast immer müssen wir in gebückter Stellung arbeiten, kein Wunder, dass mich abends der Rücken schmerzt.“
Hirgelo dagegen wurde die Arbeit am Schmelzofen zunehmend langweilig. Er wollte auch in einer Höhle arbeiten, weil da der Wind nicht so kalt wehe und es einfach wärmer sei. Er wurde deshalb bei Wurkaz vorstellig, der ihn von oben bis unten ansah und ihn grob an der Schulter fasste. „Die Kinder, die bisher dort gearbeitet hatten, sind nicht mehr zu gebrauchen, sie sind krank oder auch schon tot, Du kannst sie ersetzen und gleich mit mir kommen.“ Wurkaz sagte dies ohne eine Gefühlsregung, er hatte schon viele Kinder hier kommen und sterben sehen. Sie hatten keine Eltern, niemand wusste genau, woher sie kamen. Manche sagten, Celso habe sie geraubt oder ihren Eltern abgekauft. Aber das kümmerte oben in der Mine niemanden. Die Leute, die in der Mine arbeiteten, waren einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigt und abends froh, wenn sie selbst den Tag heil überstanden hatten.
Wurkaz brachte Hirgelo zu Walober, einem untersetzten Mann mit missmutiger Miene, der Hirgelo gleichgültig ansah, seine flache Hand in seinen Rücken drückte und ihn nach vorne in die Höhle stieß. „Da schau und duck Dich, hier rieseln immer mal wieder Steine herunter, manchmal kleinere, manchmal größere. Es wäre gut für Dich, wenn Du Dir eine Mütze besorgen würdest.“
Hirgelo ging zum Schuppen am großen Platz, wo er auch schon seine Schuhe erstanden hatte. Dort traf er aber nicht Marabeo, sondern einen jungen Mann. Seine schwarzen, leicht gelockten Haare hatte er kurz geschnitten, über seinen weit auseinanderstehenden Augen und seiner scharf geschnittenen Nase zogen sich feine Augenbrauen. Sie gaben seinem Gesicht einen weichen, fast weiblichen Anstrich. Sein muskulöser Hals und seine kräftigen Schultern aber erzählten von harter Arbeit. Das Erstaunlichste an ihm war jedoch seine dunkle Haut. Noch nie hatte Hirgelo einen derart dunklen Menschen gesehen.
Der dunkelhäutige junge Mann war erst am Tag zuvor in die Mine gekommen und sprach ihre Sprache nur schleppend. „Ich Namos“, stellte er sich vor. „Ich hier arbeiten jetzt, neu.“ Hirgelo schaute ihn neugierig an, besann sich dann und bedeutete ihm, dass er eine passende Mütze für sich suche. Namos nahm ein paar Mützen von einem Ast am Dach des Schuppens und bat Hirgelo sie anzuprobieren. Der entschied sich für eine größere Zipfelmütze, die er mit Heu auspolstern konnte und somit Schutz gegen herabfallendes Gestein bot. Während Namos ihm den Lederriemen unter dem Kinn festband, ermahnte er ihn, dies nie zu vergessen, wobei er seine Worte durch eindringliche Gesten unterstrich.
Als Namos auch in Hirgelos Haselnussrute ein paar Striche schnitzte, betrat Marabeo den Schuppen, schaute sich Hirgelos neue Kopfbedeckung genau an, prüfte die Haselnussrute mit Hirgelos Zeichen und die jetzt frisch von Namos darauf angebrachten Schnitzereien. „Gut“, brummte er und nickte Namos zu.
Abends saßen sie um das Lagerfeuer, sie hatten gut gegessen und ein paar Schluck Pastosaako getrunken. Gilger schnappte seine Trommel und schlug gedankenverlorenen einen langsamen Rhythmus. „Wir haben einen Neuen bei uns am Feuer, den Namos meine ich, scheint ein netter Kerl zu sein, obwohl er etwas anders aussieht als wir.“
Öcetim wandte sich an Namos: „Du hast schnell gelernt und sprichst schon ganz gut unsere Sprache. Ich würde gerne mehr wissen von Dir, von Deinem Land, Deinen Leuten, mich interessiert Deine Geschichte.“
„Ja“, schloss sich Hirgelo an, „erzähl mal, Namos, wie es Dir bisher so ergangen ist, und weshalb Du so eine dunkle Haut hast.“
„Also gut“, begann Namos. „Man sieht ja schon an meiner Haut, dass ich nicht von hier stamme. Von einem Land jenseits des großen Meeres komme ich, Unterstromland heißt es bei uns. In meiner Heimat haben alle Menschen solch eine dunkle Haut wie ich, das ist dort normal. Das Land liegt an einem großen Strom, der mit seinen Überschwemmungen alljährlich neue Fruchtbarkeit bringt. Viele Menschen leben dort, sie wohnen eng zusammen, dicht an dicht stehen unsere Hütten. Es gibt keine hohen Berge und schon nach einem Tagesmarsch endet das fruchtbare Gebiet, dann beginnt das todbringende heiße Sand-Land. Meine Eltern bauten Getreide an, daraus backten die Frauen Fladenbrot und brauten das berauschende Pirritu. Wir hatten Geflügel und Schafe, nie fehlte es uns an Essen und Trinken.“
„Wie kann das sein?“ fragte Öcetim ungläubig. „Dass man nie Hunger leiden muss?“
„Bei uns gibt es keine Nomaden oder Jäger, nur Bauern. Und Priester, die beobachten die Sterne und sagen dann, wann die Bauern aussähen sollen, welche Opfer den Göttern zu bringen sind. Die Priester wissen sehr viel, auch hatten sie die Zeit eingeteilt, sie nennen das Kalender.“
„Wie? Das verstehe ich nicht“, unterbrach ihn Hirgelo. „Wozu soll das gut sein und wie soll das funktionieren?“
„Ganz einfach, aber auch ganz wichtig ist das. Damit man den richtigen Zeitpunkt der Aussaat kennt und man messen kann, wie lange alles dauert. Die Priester sagen, wann ein neues Jahr beginnt, das haben sie in Monde eingeteilt, auch die einzelnen Tage sind in verschiedene Abschnitte gegliedert. Gemessen werden diese tagsüber am Schatten der Sonne und nachts am Lauf der Sterne. Die Priester vom großen Strom sind nämlich sehr klug. Sie haben ihr Wissen von dem Einen mit den drei Gürtelsternen am Himmel.“ Namos deutete nach oben. „In seinem Namen regeln sie auch die Vorratshaltung und die Verteilung der Güter, in unseren Dörfern gibt es nämlich große Vorratskammern, in denen alles Wichtige gelagert wird, so dass wir bei schlechten Ernten darauf zugreifen können.
Diese gut gefüllten Speicher reizten unser Nachbarvolk, das weiter oben am großen Fluss wohnte. Auch sie hatten meistens genügend Nahrung, litten keine Not. Doch sie waren faul und gierig, wollten immer mehr, konnten nie genug kriegen. Immer wieder überfielen sie uns, raubten unsere Vorratskammern aus, verschleppten die Frauen, bezwingen aber konnten sie uns nie. Denn der große Eine – Namos deutete auf den nächtlichen Himmel – an dessen Gürtel die drei Sterne der Gerechtigkeit, der Reinheit und der Mäßigung funkeln – war bei uns. Zusammen mit Uto, der Schlangengöttin, die sich um seinen Gürtel und um seine Lenden windet, beschützte uns dieser große Eine.“
Namos holte tief Luft, fuhr mit den Händen durch sein wirres Haar, dann sprach er weiter: „Die vom oberen Fluss waren schlimm. Bisweilen meinte der große Strom es nicht ganz so gut mit ihnen, er schenkte ihnen manchmal etwas zu viel und manchmal zu wenig Wasser. Dann waren ihre Felder nicht so fruchtbar wie sonst und ihre Ernte fiel geringer aus. Vor allem aber waren sie maßlos und neidisch auf uns.
Читать дальше