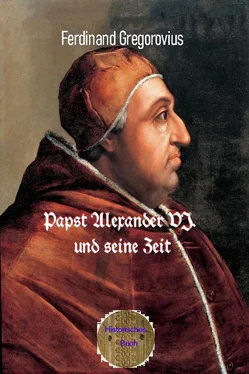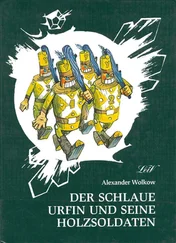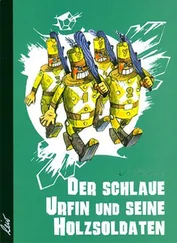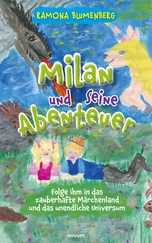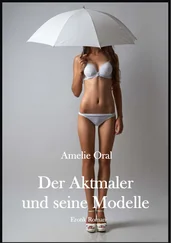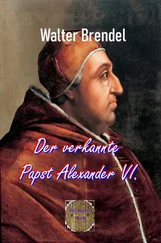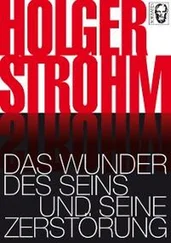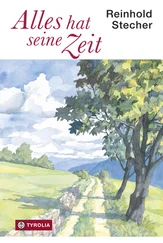Die Verwilderung der Stadt war übrigens so groß, dass es dem Papst nur mit Mühe gelang, die Ordnung wiederherzustellen. Das Rom Martins V. war noch die Stadt des vierzehnten Jahrhunderts, ein von Türmen überragtes Labyrinth schmutziger Gassen, worin das Volk in Armut und Trägheit freudelose Tage hinbrachte. Blutrache hielt die Geschlechter entzweit: Bürger lagen mit Baronen und diese miteinander in Kampf. Im Jahre 1424 erschien ein damals berühmter Heiliger in Rom, Buße zu predigen, der Franziskaner Bernardino von Siena. Der Scheiterhaufen, welchen er am 25. Juni mit Symbolen des Luxus und der Zauberei auf dem Kapitol anzündete, und die Hexe Finicella, die drei Tage später verbrannt wurde, waren Schauspiele, welche Martin an die Tage von Konstanz erinnern mussten, wenn dies nicht ohnehin der wilde Hussitenkrieg getan hätte.
Papst Martin V.
Dort hatten sie schon im vierzehnten Jahrhundert große Landschaften am See von Bracciano erworben, während sie seit uralten Zeiten Monterotondo und Nomentum wie das umliegende sabinische Land bis zu den Grenzen der Abruzzen besaßen. Denn hier hatten sie längst Tagliacozzo an sich gebracht. Um den Besitz gerade Mittelitaliens, in welches sich jetzt die Colonna eindrängten, entspann sich der Streit der beiden Familien. Martin verfuhr zwar mit den Orsini vorsichtig, die er schon in den ersten Jahren seines Papsttums zu gewinnen suchte, zumal der hochgebildete Kardinal Giordano einer seiner Beförderer zum Papsttum gewesen war; doch konnte der Kampf beider Häuser nicht lange auf sich warten lassen.
Der Aufbau des Kirchenstaates
Der Papst sah übrigens seine Brüder schnell dahinsterben: Lorenzo kam schon im Jahre 1423 in einem brennenden Turme der Abruzzen um, und Giordano starb kinderlos zu Marino am 16. Juni 1424. Antonio, Prospero und Odoardo, die Söhne Lorenzos, setzten den Stamm fort. Den jungen Antonio, Fürsten von Salerno, hoffte Martin sogar auf den Thron Neapels zu erheben; Prospero ernannte er am 24. Mai 1426 zum Kardinal von S. Georg in Velabro, proklamierte ihn aber seiner Jugend wegen erst im Jahre 1430. Martins Schwester Paola war die Gemahlin Gherardos Appiani, des Herrn von Piombino, und ihr hatte er Frascati verliehen. Catarina, eine Tochter Lorenzos, hatte er am 23. Januar 1424 mit Guidantonio Montefeltre, dem Grafen von Urbino, vermählt. Diese in Rom feierlich abgeschlossene Verbindung eröffnete die lange Reihe von Nepoten-Vermählungen des fünfzehnten Jahrhunderts. So ganz lebte Martin in den Erinnerungen seines Hauses, dass er sogar im Palast der Colonna bei den Santi Apostoli seit 1424 seinen Sitz nahm, um furchtlos unter den Römern und auf der Stätte seiner Ahnen zu wohnen. Er hatte jenen Palast neu ausgebaut. Er baute auf der Campagna auch das Schloss Genazzano; hier war er selbst geboren, und er hielt sich in ihm bisweilen auf, wenn ihn Hitze oder Pest aus Rom vertrieben. Mit Kraft und Klugheit in der Stadt herrschend, wo ihm der Magistrat, die Barone, die Kardinäle huldigten, wurde Martin V. auch in den Provinzen des Kirchenstaates vom Glück begünstigt. Ein nur loser Verband mit der päpstlichen Autorität gab jenen Ländern kaum noch den Begriff eines Staates. Die Städte in Umbrien, der Romagna und den Marken, der Landschaft am adriatischen Meer, waren entweder frei oder in der Gewalt von Tyrannen, welche die Hoheit der Kirche hier gar nicht, dort nur als Vikare anerkannten. Unter diesen Vasallen war Braccio von Montone der mächtigste. Martin hatte seine eigene Rückkehr nach Rom nur durch den Vertrag mit diesem Condottiere 3möglich gemacht und sich hierauf seiner Waffen bedient, um Bologna zum Gehorsam zurückzuführen. Aber er hatte ihm Perugia, Assisi, Todi und andere Orte als Vikariate überlassen müssen. Braccio, dieser furchtbare Tyrann Umbriens wartete nur auf die Gelegenheit, sich aus Ländern der Kirche ein Fürstentum zu gründen. Er wurde indes in die Verwirrungen des Königreichs Neapel hineingezogen, wo er sein Ende fand.
Dieses alte Lehn des Heiligen Stuhls nahm in der weltlichen Politik Martins die erste Stelle ein. Schon manche Päpste hatten es an ihre Verwandten zu bringen gesucht, und auch er hoffte darauf; denn die Königin Johanna von Neapel, die letzte Erbin des Hauses Anjou-Durazzo war ein charakterloses Weib, ein Spielball der Hofkabalen und dem Willen ihres Günstlings, des Groß-Seneschall Ser Gianni Carraciolo, Untertan. Vor seiner Rückkehr nach Rom hatte Martin diese Königin Johanna II. anerkannt und durch seinen Gesandten krönen lassen; aber schon in Florenz geriet er in Streit mit ihr, wozu die Rückstände des Tributs die nicht unwillkommene Veranlassung boten. Noch mehr erzürnte es ihn, dass die Königin Sforza nicht unterstützte, nachdem sie diesen General ausgeschickt hatte, Braccio aus dem Kirchenstaate zu vertreiben. Der beleidigte Sforza forderte Ludwig von Anjou zur Eroberung des Königreichs auf, und diesem Plane gab auch Martin noch in Florenz seine Zustimmung. Als nun jener Condottiere die Fahne Anjou in Neapel wieder erhob, trieb dies die haltlose Königin zu dem folgenschweren ntschluss, den König Alfonso von Aragon in ihr Land zu rufen.
Streit um Neapel
Der kühne Alfonso (1401-1458) belagerte eben Bonifazio in Korsika, als ihm neapolitanische Boten die Aussicht auf die Krone des herrlichsten Reiches eröffneten und ihn aufforderten, Johanna von ihren Bedrängern, Sforza und Anjou, zu befreien. Er schickte eine Flotte ab, welche Neapel entsetzte, dann traf er selbst dort im Juli 1421 ein, worauf ihn die Königin als Nachfolger adoptierte. Dies brachte den Papst auf; denn wie durfte er den Thron Neapels von einem Monarchen einnehmen lassen, welcher bereits Aragon, Sizilien und Sardinien besaß? Fortan stritten beide Prätendenten um die neapolitanische Krone: auf der Seite Aragons kämpfte Braccio, welchen Johanna herbeigerufen, zum Befehlshaber ernannt und mit Capua und Aquila beliehen hatte; auf der Seite Anjous standen Braccios Todfeinde: Sforza und der Papst. Ludwig von Anjou war unglücklich; bald kam er hilfeflehend nach Rom: und Martin suchte jetzt, was ihm die Waffen versagt hatten, mit diplomatischen Künsten zu erreichen. Die wankelmütige Johanna entzweite sich in der Tat mit Alfonso; sie widerrief am 1. Juli 1423 dessen Adoption und übertrug diese zur großen Freude des Papstes auf Ludwig von Anjou. Martin, der jetzt alles aufbot, diesen zur Anerkennung zu bringen, lud den Herzog von Mailand ein, mit ihm gemeinsam Aragon von Italien fernzuhalten, und wirklich unterstützte ihn Filippo Visconti durch eine genuesische Flotte. Braccio unterdes, schon Herr Capuas und Parteigänger Alfonsos, war gegen Aquila gerückt, welches sich noch für Johanna behauptete. Wenn er diese Stadt mit seinen Besitzungen vereinigte, so würde der große Condottiere von dort wie von Perugia aus einen eisernen Ring um Rom gelegt haben.
Der Papst erkannte die Wichtigkeit Aquilas; er schickte Truppen dem Sforza zu Hilfe, welchen die Königin im Dezember 1423 zum Entsatz jener Stadt hatte ausrücken lassen. Aber dieser berühmte Kriegsmann versank 1424 vor den Augen seines Heeres in den Wellen des Flusses Pescara, als er ihn gepanzert durchreiten wollte. Sforza, der sich von der Ackerscholle zu den höchsten Ehren emporgeschwungen und Italien mit seinem Ruhm erfüllt hatte, vererbte seinen Namen, seine Güter, seinen Ehrgeiz und ein größeres Glück einem seiner Bastarde, dem bald weltberühmten Francesco, welcher seine Laufbahn unter den Fahnen des Vaters begonnen hatte, sie im Dienst der Königin von Neapel und anderer Herren fortsetzte und auf dem Herzogsthron Mailands glorreich beschloss.
Der Untergang seines einzigen ebenbürtigen Gegners eröffnete jetzt Braccio unermessliche Aussichten auf Erfolg. Dem Papst ließ er sagen, er wolle ihn bald soweit bringen, dass er für ein Goldstück hundert Messen lesen werde. Er verdoppelte seine Anstrengungen, Aquila zu erobern, aber diese einst vom Hohenstaufen Konrad gegründete Stadt glänzte durch den Heldenmut ihrer Bürger, die den Feind vor den Mauern dreizehn Monate hindurch siegreich bekämpften. Zu ihrem Entsatz schickten Martin und Johanna Truppen unter Lodovico Colonna, Jacob Caldora, Francesco Sforza, so dass sich in beiden Lagern die ersten Kriegskapitane der Zeit versammelten. Endlich entschied am 2. Juni 1424 eine Schlacht das Schicksal Süditaliens und auch des Kirchenstaates: Braccio fiel verwundet in die Hände des Feindes. Ein wütender Ausfall der Bürger gewann den Sieg, und die Befreier zogen in die jubelnde Stadt ein. Den sterbenden Condottiere trug man auf einem Schilde aus der Schlacht; er sprach kein Wort mehr; er verschied am folgenden Tage. Fast gleichzeitig mit Sforza geboren, starb er auch in demselben Jahre wie dieser. Die Namen dieser großen Kapitäne lebten in jenen militärischen Schulen fort, welche sie gestiftet hatten; denn die Sforzeschi und die Bracceschi wurden zu Parteien mit politischer Färbung, wie einst Guelfen und Ghibellinen 4im Mittelalter.
Читать дальше