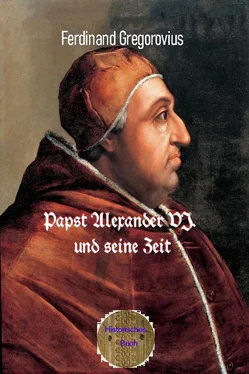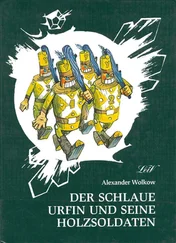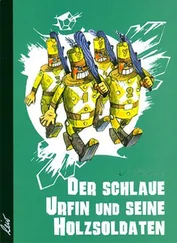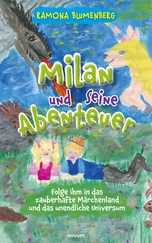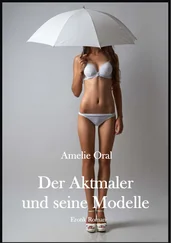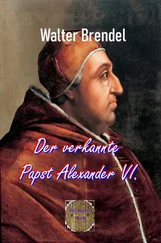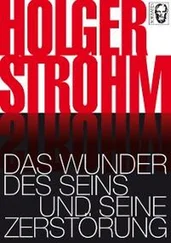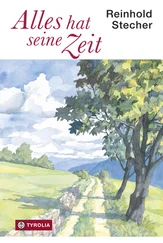Die Theologen des Ostens und Westens, die späten Nachfolger des Origenes und Augustinus, maßen einander mit Misstrauen und Eifersucht, und sie stürzten sich alsbald voll Leidenschaft in Disputationen über die beide Kirchen trennenden Dogmen, um eine Grundlage für deren Vereinigung zu finden. Die Byzantiner konnten freilich mit Ironie bemerken, dass sie die lateinische Kirche selbst in der heftigsten Spaltung über die Grenzen der Autorität des abendländischen Patriarchen vorfanden. Sie würden am liebsten sich wieder eingeschifft haben, wenn sie nicht die Bitten ihres bedrängten Kaisers zur geduldigen Unterwerfung nötigten.
Frankreichs pragmatische Sanktion
In Basel hatte sich unterdes Cesarini vergebens bemüht, ein Schisma zu vermeiden. Auch er verließ endlich die dort noch versammelten Väter, um nach Ferrara zu gehen. Jene machten jetzt Louis d'Aleman zu ihrem Vorsitzenden, den leidenschaftlichsten Kämpfer und das glänzendste Talent der Reformpartei. Es gab demnach zwei Konzile, die einander verneinten; dieses zu Basel erklärte den Papst am 24. Januar 1438 für abgesetzt, jenes zu Ferrara erklärte sich als ökumenisches Konzil unter dem Vorsitz des Papstes, und es gebot den Baslern, binnen Monatsfrist in Ferrara zu erscheinen.
D'Aleman, Johann von Segobia, der große Jurist Ludovico de Ponte und Nicola de' Tudeschi, Erzbischof von Palermo, die Freunde und Gesandten Alfonsos von Aragon ermunterten die Versammlung in Basel zum Widerstand. Auch Karl von Frankreich verwarf das Konzil in Ferrara. Auf der Synode zu Bourges ließ er die meisten Reformdekrete der Basler als pragmatische Sanktion, ein zu bleibender Dauer bestimmtes Staatsgrundgesetz, für Frankreich zum Gesetz erheben. Dieses Land allein erhob sich damals zu der kühnen Tat, die Selbständigkeit seiner Nationalkirche zu sichern. Was das Deutsche Reich betrifft, so hatte sich dort Sigismund ohne Erfolg bemüht, den Papst mit den Konzilen zu versöhnen. Dieser letzte Herrscher vom Hause Luxemburg starb am 9. Dezember 1437, sitzend auf dem Thron in kaiserlichen Gewändern, noch in der Todesstunde von irdischer Eitelkeit erfüllt. Er war ein tätiger und freundlicher Herr gewesen, doch vom Glücke nie begünstigt: groß in Konstanz, klein in Basel, unfähig, die wichtigste Aufgabe seiner Reichsgewalt, die deutsche Kirchenreformation durchzuführen. Sein Erbe war sein Schwiegersohn Albrecht von Österreich, als Gemahl Elisabeths König von Ungarn und Böhmen, dann durch die Frankfurter Wahl am 18. März 1438 König der Römer. Eugen anerkannte ihn sofort, hoffend, dass er als Advokat der Kirche gegen die Basler einschreiten werde. Doch er drang nicht durch, denn im Deutschen Reiche befestigte sich der Grundsatz der Neutralität.
Ferrara wurde bald für die Kurie unsicher. Visconti schickte im Frühjahr 1438 Piccinino in die Romagna, wo er sich Bolognas bemächtigte. Hierauf erhoben sich Imola, Forli und andere Städte. Selbst Ravenna erklärte sich für den Mailänder Herzog, dessen Oberhoheit der letzte Polentane Ostasio V. anerkennen musste. So wurden die Venetianer aus Ravenna verdrängt, wo sie schon seit 1404 durch Verträge mit jenem Signorenhaus sich festzusetzen gesucht hatten. Doch benützten sie seither jede Gelegenheit, in Besitz jener Stadt zu kommen, was sie in fortdauernden Streit mit den Päpsten brachte.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.