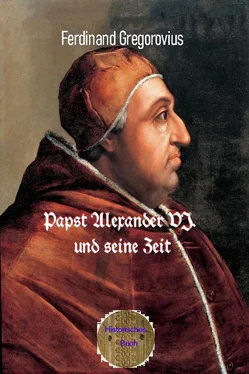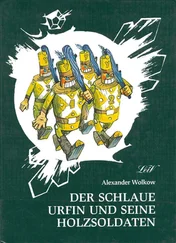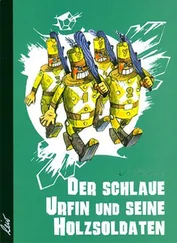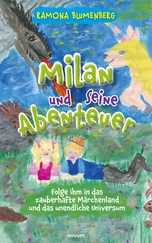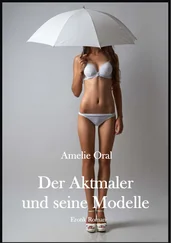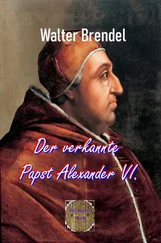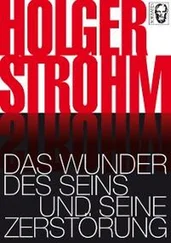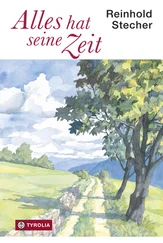Im Jahre 1439 erlitt auch Zagarolo ein gleiches Los; denn der von Rache glühende Lorenzo war mit Truppen zurückgekehrt und hatte sich dort festgesetzt. Vitelleschi erstürmte den Ort am 2. April, nahm den Colonna selbst gefangen und schickte ihn zu Eugen IV. nach Bologna, wo er wider Erwarten freundlich behandelt wurde. Sodann ward Zagarolo dem Erdboden gleichgemacht. Bei solchem Verfahren durfte man sich nicht wundern, dass Latium unter allen Provinzen Italiens die am mindesten angebaute war. Es scheint, dass Vitelleschi diese barbarischen Handlungen ohne Wissen des Papstes beging; doch hören wir nicht, dass Eugen gegen die Gewalttaten seines Günstlings Einspruch erhob. Aber die Kunde von der Zerstörung Palestrinas verbreitete sich in der Welt, und das Baseler Konzil machte daraus eine Anklage wider Eugen. Die Kriege im Kirchenstaat unter diesem Papst waren überhaupt so vernichtend wie wenige vorher. Viele Städte in Campanien, Tuskien und der Sabina wurden in Schutthaufen verwandelt. Poggio, der Freund Martins V., dessen Regierung er als ein goldenes Zeitalter gepriesen hatte, sagte daher von Eugen: »Selten hat die Regierung eines andern Papstes über die Provinzen der römischen Kirche gleiche Verwüstung und gleiches Unheil gebracht. Die vom Kriege gegeißelten Landschaften, die verheerten und zertrümmerten Städte, die verwüsteten Äcker, die von Räubern vergewaltigten Straßen, mehr als fünfzig teils zerstörte, teils von Kriegsknechten geplünderte Orte haben jede Art der Wut erfahren. Viele Bürger sind nach der Vernichtung ihrer Stadt als Sklaven verkauft, viele in Kerkern durch Hunger umgekommen.« Eine ähnliche Klage erhob der mit Eugen IV. befreundete Blondus, welcher in seinem Zeitalter mehr als dreißig zerstörte Städte zählte, auf deren Ruinen kaum ein armer Landbauer zurückgeblieben war.
Erbstreit um Neapel
Während Vitelleschi die Herrschaft der Kirche im Römischen herstellte, wurde der Papst durch Alfonso von Aragon und das Konzil bekämpft. Der König Ludwig, welchen er anerkannt hatte, starb erblos zu Cosenza im November 1434, und schon am 2. Februar 1435 erlosch durch den Tod Johannas II. das Haus Anjou-Durazzo. Zu ihrem Erben hatte die Königin Ludwigs abwesenden Bruder, René Grafen der Provence und Herzog von Anjou, eingesetzt. Aber die Gültigkeit ihres Testaments bestritten Alfonso, der von Sizilien in das Königreich eilte, und Eugen, welcher Neapel als heimgefallenes Kirchenlehn beanspruchte. Der Papst gebot den Neapolitanern, keinen der königlichen Prätendenten anzuerkennen. In diesem Eroberungskriege, welchen nun Alfonso begann, trat auch Visconti, der Herzog von Mailand, als sein Gegner auf. Visconti, Herr Genuas, den Spaniern feind und den Franzosen zugetan, hatte eine genuesische Flotte zur Rettung des belagerten Gaeta abgeschickt, und diese vernichtete die Schiffe Alfonsos von Aragon am 5. August 1435 bei Ponza. Alfonso selbst, seine Brüder Johann, König von Navarra, und Don Enrico, Großmeister von S. Jacob, seine ersten Barone fielen in Gefangenschaft.
Selten war ein so glänzender Sieg erfochten: mit einem Schlage, so sagte man sich, war der Krieg beendigt worden. Die Venezianer gerieten in Furcht; sie urteilten, dass Visconti sich zum Herrn Italiens machen könne, wenn er diesen Erfolg zu benützen verstand. Die Genuesen führten ihre kostbare Beute in ihre Hafenstadt und von dort nach Mailand. Der Herzog, ein Mann von unberechenbarem Wesen, empfing den König als einen gefangenen Feind, aber er selbst wurde bald durch dessen Genialität und Ritterlichkeit gefangen und bezaubert. Er sah die Richtigkeit seiner Vorstellungen ein, dass auf dem Throne Neapels Alfonso von Aragon für Mailand eine sichere Stütze, René von Anjou eine drohende Gefahr sein müsse. Er entließ Alfonso fürstlich beschenkt, ohne Lösegeld, als seinen ihm innig verbundenen Freund. Diese Großmut, deren Beispiele nur in romantischen Rittergedichten zu finden waren, machte unbeschreibliches Aufsehen in der Welt. Der Papst war tief aufgebracht. Das Volk Genuas, den Katalanen todfeind, sah sich um den Gewinn des ruhmreichsten Sieges betrogen, erhob sich wütend am 12. Dezember, erschlug den mailändischen Befehlshaber und stellte seine Unabhängigkeit unter Francesco Spinola wieder her.
Unterdes war Alfonso nach Gaeta zurückgeeilt, welches sich seinem Bruder Pedro ergeben hatte. Er rüstete Schiffe aus, Neapel zu erobern, wo seit dem Oktober Isabella, das kluge Weib Renés, die Regierung führte, während sich ihr Gemahl in der Haft des Herzogs von Burgund befand. Diesen René musste jetzt Eugen IV. als Prätendenten anerkennen oder doch unterstützen, denn Alfonso bedrängte den Kirchenstaat von Terracina aus, im Einverständnis mit den Colonna und den Condottieren. Wir sahen bereits, wie Vitelleschi diese Gefahr durch seine Kraft beseitigte. Im April 1437 zog er als päpstlicher Legat 11ins Neapolitanische, der Regentin Isabella zur Hilfe. Dort hatte er jedoch kein Glück, nur dass er Antonio Orsini, den Prinzen von Tarent, den mächtigsten Anhänger Alfonsos, durch Überfall gefangen nahm, wofür ihn Eugen am 9. August 1437 zum Kardinal von S. Lorenzo in Damaso erhob. Vitelleschi schloss im Dezember Waffenstillstand zu Salerno mit Alfonso und brach diesen sofort, indem er einen hinterlistigen Anschlag auf die Person des Königs machte; mit allen Parteien verfeindet, verließ er endlich das Königreich, schiffte sich an der adriatischen Küste ein und ging über Venedig nach Ferrara zum Papst.
Das Konzil in Ferrara
Eugen war damals wieder im Kampfe mit dem Konzil und schon nahe daran, als Sieger daraus hervorzugehen. Diese Kirchenversammlung hatte ihren ersten Triumph über die Papstgewalt mit wenig Geschick und vielleicht mit zu viel Leidenschaft verfolgt. Ihre Reformdekrete wegen Abschaffung der maßlosen Einkünfte der Kurie trafen diese am empfindlichsten. Das Papsttum sah sich in Gefahr, die Quellen seiner Reichtümer, die aus der Brandschatzung der Christenheit, durch ungezählte Steuern flossen, einzubüßen und seine Autorität an die Gebote einer parlamentarischen Mehrheit abzutreten; es rüstete sich deshalb zum Widerstande auf Leben und Tod, und an Mitkämpfern fehlte es ihm nicht. Sein Anhang auf den Bänken zu Basel wuchs; seine Rechte verteidigten gelehrte Theologen, wie Juan Torquemada, der eifrigste Verfechter der päpstlichen Unfehlbarkeit seit Thomas von Aquino, und der Camaldolenser Traversari, während sich die Sympathie der Fürsten und Völker für das Konzil durch die abstumpfende Zeit und die geringen Reformresultate minderte. Ein Gegenstand des Streites war auch die Union mit der griechischen Kirche, wegen welcher seit langem unterhandelt wurde. Jede der Parteien begehrte diesen Ruhm für sich, und beide verständigten sich dahin, dass für jene Union das Konzil an einen den Griechen bequemen Ort zu verlegen sei. Die Basler wünschten dafür Avignon, der Papst Venedig oder Florenz. Endlich schob die römische Partei ein Dekret unter, welches im Namen des Konzils dieses selbst in eine italienische Stadt verlegte, und Eugen IV. erklärte durch eine Bulle am 18. September 1437, dass dies Ferrara sei. Die Griechen wandten sich von den Baslern ab, bereit, dem Papst zu folgen, welcher demnach dies Unionswerk in Händen hielt. Sein Glück stieg auf, das Ansehen der Basler sank.
Am 8. Januar 1438 eröffnete der Kardinal Albergati das sehr spärlich und nur von Italienern besuchte Konzil in Ferrara. Eugen selbst zog am 27. mit großer Pracht in diese Stadt ein, und am 4. März erschien auch Johannes VIII., Kaiser von Byzanz (1425-1448). Der Nachfolger Constantins kam mit seinem Bruder Demetrius, mit dem greisen Patriarchen Joseph und vielen Würdenträgern der orientalischen Kirche. Es befanden sich darunter die gelehrten Bischöfe Marcus Eugenikos von Ephesus, Isidorus von Russland, Bessarion von Nicäa und dessen Lehrer, der Platoniker Gemistos Plethon. Nach seinem pomphaften Einzuge in Venedig auf dem Bucentaur und nach den Festen in jener Lagunenstadt, auf deren Dom die Spolien 12on Byzanz schon seit mehr als 200 Jahren prangten, zog er in Ferrara ein, sitzend auf einem mit Purpur bedeckten Ross, während die Markgrafen von Este einen himmelblauen Baldachin über dem Haupt ihres Gastes entfalteten. Wenn diese traurige Kaisergestalt des Ostens zu Ferrara dem damaligen Kaiser des Westens hätte begegnen können, so würden sie einer des andern schwindsüchtige Majestät belächelt und mit Erstaunen bemerkt haben, dass, während die legitime Reichsgewalt, welche sie beide vertraten, zu einem bloßen Titel sich abgezehrt hatte, der Bischof von Rom allein noch eine tatsächliche Autorität in der Welt besaß. Indes war die Erscheinung des Paläologen beim Konzil nur ein theatralischer Sieg der lateinischen Kirche; denn die Hand, welche der byzantinische Kaiser dem Papst zur Versöhnung reichte, war eine Totenhand.
Читать дальше