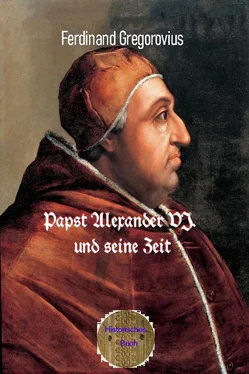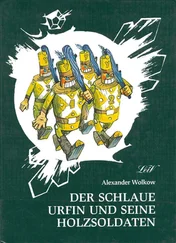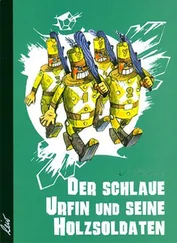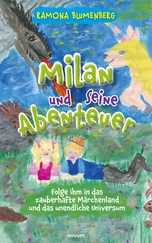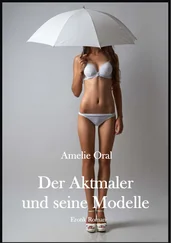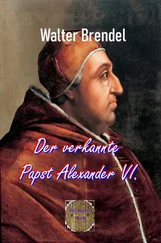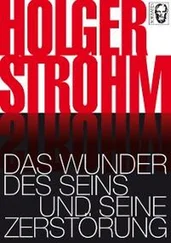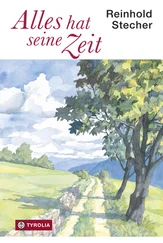An die Stelle des theokratischen Prinzips trat die Politik selbständiger Staaten. Nationale Ländermassen oder monarchische Erbreiche bildeten sich, wie Spanien, Frankreich, England und Österreich. Sie rangen nach der europäischen Vorherrschaft. Kongresse der Mächte traten an die Stelle der Konzile, das politische Gleichgewicht an die Stelle der internationalen Autorität des Kaisers und Papstes.
Das Papsttum selbst, tief erschüttert und alt geworden, fand sich, nach Überwindung des großen Schisma 1, in einer neuen Zeit im veralteten Rom wieder, doch nicht mehr als die weltbewegende Universalgewalt des Abendlandes. Wenn es auch, noch stark durch sein Verwaltungssystem, sein dogmatisches und hierarchisches Ansehen wiederherzustellen vermochte, so war doch seine große Idealmacht schon untergegangen. Die Epoche der Renaissance Europas wurde die Zeit seiner eigenen profansten Verweltlichung auf den Grundlagen eines kleinen monarchisch werdenden Fürstentums. Diese zeitgemäß praktische, aber der Kirche selbst nachteilige Verwandlung erklärt sich aus dem Selbständig werden der Staaten und Volksgeister, aus dem Verlust der großen geistlichen Aufgaben des Mittelalters, aus dem Aufhören des weltgeschichtlichen Kampfes mit der Reichsgewalt, und endlich aus dem Fall der städtischen Freiheit Roms.
Der Fortbestand der römischen Republik würde die Päpste des fünfzehnten Jahrhunderts ohne Frage genötigt haben, ihre Tätigkeit hauptsächlich auf die geistliche Sphäre zu wenden: unumschränkte Herren Roms geworden, verließen sie ihre höchsten Aufgaben als Oberpriester der Christenheit, um sich als weltliche Fürsten ihren Kirchenstaat einzurichten. Sie versenkten sich aus Herrschbegier und Familientrieb in die politischen Händel der italienischen Staaten, und doch besaßen sie nicht Stärke genug, um die wirkliche Herrschaft über Italien zu erlangen. Dieses Land wurde nicht minder durch die Nepotenpolitik, der Vetternwirtschaft seiner Päpste, als durch die dynastische Eifersucht seiner Fürsten endlich die Beute fremder Eroberer.
Das Papsttum der Renaissance, entstanden aus den es umformenden Trieben der Zeit, bietet meist nur ein abschreckendes Schauspiel dar, und die hohen Verdienste einiger Päpste um die Kultur der Wissenschaft und Kunst ersetzten nicht den unermesslichen Verlust, den die allgemeine Kirche durch die Ausartung der schrankenlos gewordenen Papstgewalt erlitt. Die Natur dieser Übel zu verschleiern oder ihre wahren Ursachen zu fälschen, ist heute ein vergebliches Bemühen. Wenn die Päpste der Renaissance die von ganz Europa begehrte Reform nicht verweigert, wenn sie die Vorteile des Papsttums nicht an die Stelle der Kirche gesetzt hätten, so würde die große Kirchentrennung schwerlich erfolgt sein. Europa sah sich mit einer neuen römischen Absolutie bedroht, die umso unerträglicher war, weil ihr keine erhebende religiöse oder soziale Idee zugrunde lag. Gemeine weltliche Triebe der Herrschsucht und Habsucht beherrschten das Papsttum in einer Zeit schrankenloser Sittenverderbnis. Die murrenden Völker duldeten die tiefste, heute kaum glaublich scheinende Entheiligung des Christentums und die fortgesetzten Eingriffe der alles verschlingenden Kurie, des päpstlicher Hofes, in ihre Staaten und Bistümer, in ihr Gewissen und ihr Vermögen, bis im Beginne des sechzehnten Jahrhunderts das Maß voll ward. Deutschland, durch die Reichsidee seit langen Jahrhunderten an Rom gekettet, riss sich vom Papsttum durch seine nationale Reform los, und das Resultat der unerträglichen Misshandlung edler Völker war die Selbständigkeit der germanischen Welt und durch sie eine neue Kultur, deren Mittelpunkt nicht mehr die Kirche ist. In der Befreiung der Völker und Staaten von der Führung Roms durch die deutsche Reformation endeten demnach die zweite römische Weltherrschaft und das Mittelalter überhaupt.
Die Gärung der europäischen Geister in diesem denkwürdigen Umwandlungsprozess erzeugte gewaltige politische Erschütterungen und dämonische Leidenschaften, während das Licht der Wissenschaft und die Blüte der Schönheit über der Welt aufgingen, um in ewigen Denkmälern fortzuleben.
Nach seiner Rückkehr vom Konstanzer Konzil, wo er zum Papst gewählt wurde, beschäftigte Martin V. (1417-1431) die schwere Aufgabe, den Kirchenstaat wiederherzustellen, die Stadt aus ihrem Verfall zu heben . Sie gelang ihm so weit, dass er die Fundamente legen konnte, auf denen seine Nachfolger ihr Papstkönigtum aufgebaut haben. Das erschöpfte römische Volk widerstand ihm nicht, es begrüßte vielmehr in seinem erlauchten Mitbürger den Befreier von Tyrannen und den Friedensstifter. Zwar lebten noch die republikanischen Grundsätze, aber nur in einzelnen Geistern. Rom konnte von der alten Freiheit nichts mehr bewahren als die Selbstregierung der Gemeinde, ein Gut, welches freilich noch unschätzbar war. Martin hielt diese kommunale Verfassung stets in Ehren. Auf seinen Befehl trug Nicolaus Signorili, der Schreiber des Senats, die Rechte der Stadt in ein Buch zusammen. In hergebrachten Formen regierte der Magistrat. Doch diese Körperschaft besaß nur noch kommunale, polizeiliche und richterliche Befugnisse.
Die Verwilderung der Stadt war übrigens so groß, dass es dem Papst nur mit Mühe gelang, die Ordnung wiederherzustellen. Das Rom Martins V. war noch die Stadt des vierzehnten Jahrhunderts, ein von Türmen überragtes Labyrinth schmutziger Gassen, worin das Volk in Armut und Trägheit freudelose Tage hinbrachte. Blutrache hielt die Geschlechter entzweit: Bürger lagen mit Baronen und diese miteinander in Kampf. Im Jahre 1424 erschien ein damals berühmter Heiliger in Rom, Buße zu predigen, der Franziskaner Bernardino von Siena. Der Scheiterhaufen, welchen er am 25. Juni mit Symbolen des Luxus und der Zauberei auf dem Kapitol anzündete, und die Hexe Finicella, die drei Tage später verbrannt wurde, waren Schauspiele, welche Martin an die Tage von Konstanz erinnern mussten, wenn dies nicht ohnehin der wilde Hussitenkrieg getan hätte.
Räuberschwärme machten die Landschaft unsicher. Ein Räubernest Montelupo ließ Martin zerstören, einige Bandenhäupter hinrichten, und die Sicherheit kehrte zurück in Tuskien. Dagegen waren die meisten römischen Adelsgeschlechter verschuldet und verarmt. Die Anibaldi saßen machtlos auf ihren lateinischen Erbgütern, nicht minder die Conti, die Gaetani und Savelli. Nur die Orsini und Colonna, waren noch stark genug, um in Rom Bedeutung zu haben. Beide Geschlechter besaßen außer ihren Landgütern auf beiden Seiten des Tiber auch große Lehen im Königreich Neapel, und sie hatten in den letzten Zeiten des Schisma durch den Kriegsruhm einiger ihrer Mitglieder Ansehen erlangt. Ihre ererbte Feindschaft fand jetzt neue Nahrung, seitdem ein Colonna (Martin V.) Papst geworden war. Liebe zu seinem Hause wie das Bedürfnis eigener Sicherheit trieben gerade Martin V. zu einem maßlosen Nepotismus, und mit ihm begann das Bestreben der Päpste, ihre Familien auf Kosten bald Neapels, bald des Kirchenstaates groß zu machen. Der Papst selbst mehrte die Erbgüter des Hauses durch viele Kastelle im römischen Gebiet, welche er von Abgaben befreite. Die Colonna erhielten nach und nach Marino, Ardea, Frascati, Rocca di Papa, Petra Porzia, Soriano, Nettuno, Astura, Palliano und Serrone, und sie wurden so die Gebieter des größten Teils von Latium im mittleren Italien. Selbst in fernen Burgen Umbriens und der Romagna gab der Papst seinen Nepoten das Besatzungsrecht. Aber die Vermehrung der Hausmacht Colonna musste neue Fehden mit ihren Erbfeinden herbeiziehen. Während der Kern der Besitzungen jener in Latium lag, herrschten die Orsini in Tuskien und der Sabina 2.
Martin V.
Nach seiner Rückkehr vom Konstanzer Konzil, wo er zum Papst gewählt wurde, beschäftigte Martin V. (1417-1431) die schwere Aufgabe, den Kirchenstaat wiederherzustellen, die Stadt aus ihrem Verfall zu heben. Sie gelang ihm so weit, dass er die Fundamente legen konnte, auf denen seine Nachfolger ihr Papstkönigtum aufgebaut haben. Das erschöpfte römische Volk widerstand ihm nicht, es begrüßte vielmehr in seinem erlauchten Mitbürger den Befreier von Tyrannen und den Friedensstifter. Zwar lebten noch die republikanischen Grundsätze, aber nur in einzelnen Geistern. Rom konnte von der alten Freiheit nichts mehr bewahren als die Selbstregierung der Gemeinde, ein Gut, welches freilich noch unschätzbar war. Martin hielt diese kommunale Verfassung stets in Ehren. Auf seinen Befehl trug Nicolaus Signorili, der Schreiber des Senats, die Rechte der Stadt in ein Buch zusammen. In hergebrachten Formen regierte der Magistrat. Doch diese Körperschaft besaß nur noch kommunale, polizeiliche und richterliche Befugnisse.
Читать дальше