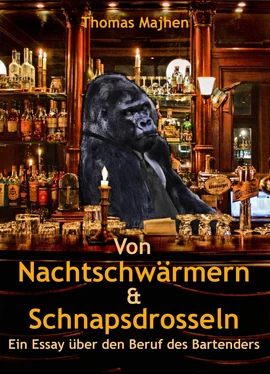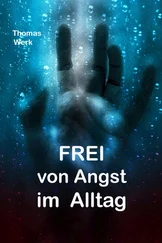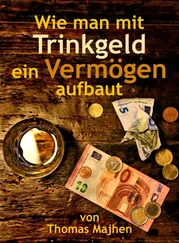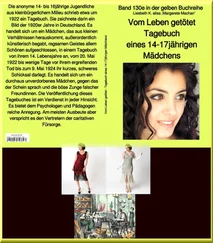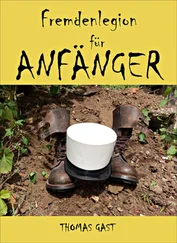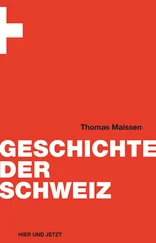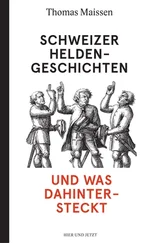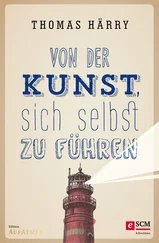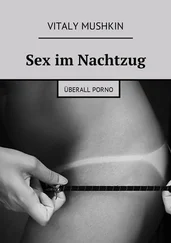Was nun folgt ist der Hauptteil der Bewirtung. Trotzdem werde ich ihm den kleinsten Teil dieses Kapitels widmen. Denn letztlich sitzen Sie nur da, schlürfen gelegentlich an Ihrem Drink, beobachten die Leute, spielen an Ihrem Handy und sehen Ihr Tun nur dann und wann durch den lästigen Versuch Ihrer Begleitung unterbrochen, ein Gespräch mit Ihnen anzuzetteln.
Ich oder meine Berufsgenossen kommen nur dann wieder ins Spiel, wenn der Inhalt Ihres Glases zur Neige geht, Sie eine Runde Schnaps für zwischendurch bestellen wollen, nach einer Schale Nüsse oder sonstigem Knabberspaß verlangen, den Weg zur Toilette erfragen oder aber gerne eine exakte Wegbeschreibung zum nächsten Restaurant mit papua-neuguineischer Küche, frittierten Salzwasserkrokodilzehen auf der Karte und einem Kellner, der fließend Unserdeutsch spricht, haben möchten. Das alles ist es, was man gemeinhin und im weiteren Sinne unter Bewirtung versteht.
Wirklich interessant wird es erst wieder dann, wenn Sie zu dem Schluss kommen, sich genügend die Sinne benebelt zu haben und endlich dazu entschließen, Ihre Zeche zu bezahlen. Das ist der Moment, der in jedem Kellner oder Barmann ein leichtes Kribbeln hervorruft und oftmals auch bei den Gästen ein Gefühl verursacht, das einem mäßigen Schlag in die Magengegend gleichkommt.
Die in einem solchen Moment in beiden Parteien des Geschehens kreisenden Gedanken könnten gegensätzlicher kaum sein: der eine hat seine Dienste bereits in Vorleistung gebracht, erwartet nun die Begleichung der hierfür anstehenden Kosten plus einem angemessenen Aufschlag, mit dem der Bezahlende seine Wertschätzung gegenüber seiner Person und der Qualität seiner Arbeit zum Ausdruck bringt. Der andere hat gewissermaßen auf Pump geschlemmt und bekommt nun am Ende des Vergnügens die Quittung dafür präsentiert. Er muss also für etwas bezahlen, das er bereits in Anspruch genommen hat und nicht für etwas, dem er noch mit freudiger Erwartung entgegensieht.
Das ist ein gravierender Unterschied. Denn im Gegensatz zur Situation in einem Supermarkt, wo Ihnen die Ware erst dann gehört, wenn Sie sie an der Kasse durchgeschleust und bezahlt haben, haben Sie sie sich in einer Bar oder einem Restaurant bereits buchstäblich einverleibt. Sie mögen unterbewusst denken, die fragliche Ware gehöre längst Ihnen und wer könnte Sie jetzt noch auffordern, sie wieder herauszugeben. Und doch kommt nun einer dahergelaufen und möchte Ihnen etwas wegnehmen: Ihr Geld. Eine unangenehme Situation, die in vielen Menschen einen starken Widerwillen hervorruft.
Es ist ganz ähnlich wie mit dem Abbezahlen eines Kredits. Sie fahren das Auto bereits seit einiger Zeit und betrachten es längst als Ihr Eigentum, trotzdem ist jeden Monat aufs Neue eine schmerzliche Summe fällig. Je länger die Laufzeit des Kredites, desto ungerechter wird Ihnen das Einfordern des Ratenbetrages durch den Gläubiger vorkommen und umso widerwilliger werden Sie den Betrag begleichen.
Im Kleinformat trifft dieser psychische Effekt auch auf das Bezahlen der Rechnung im Restaurant zu. Sie werden die Rechnung genau überprüfen (und Sie tun gut daran) und werden die Summe vielleicht als ungerechtfertigt hoch einstufen – dass Sie die Karte selbst studiert und alle Preise vor Ihrer eigenen Nase stehen hatten, spielt hier keine Rolle mehr. Sie sehen nur eine große Zahl und staunen nicht schlecht darüber, wie sich der Abend zusammengeläppert hat. Nicht selten kommt es an diesem Punkt immer wieder zu Diskussionen, selbst dann, wenn die Rechnung völlig korrekt ist. Stets aufs Neue bekommt man zu hören: „Was? So viel für einen Aperol-Sprizz? Im Restaurant *sowieso* bezahl ich dafür nur die Hälfte!“. Dass das Trinkgeld nun zu wünschen übrig lassen wird, kann sich in einer solchen Situation jeder selbst ausmalen.
Der letzte Eindruck, den beide Parteien nun voneinander haben, ist der entscheidende und wird ausschlaggebend dafür sein, was sie in Zukunft vom jeweils anderen halten werden und ob es überhaupt ein Wiedersehen geben wird. Service und Qualität tadellos, aber für Ihren Geschmack überteuert? Sie werden sich wohl einen anderen Platz zum gelegentlichen Verweilen suchen. Ein zwar recht netter Gast, der mich aber mit einem Almosen abgespeist hat, das schon an Frechheit grenzt? Na hoffentlich kommt der nicht so schnell wieder!
Manchmal merken Gast und Gastwirt im Verlauf der Bewirtung irgendwann, dass sie einfach nicht auf einer Linie sind. Die Zeit hierfür ist meist lange genug und Gelegenheiten bieten sich zu Hauf. Oft ist das Personal aber auch einfach nur gestresst oder der ständigen Routine überdrüssig.
Wenn Sie das nächste Mal eine Bar oder ein Restaurant betreten, denken Sie also daran, dass sich das Personal schon bei Ihrem ersten Anblick möglicherweise insgeheim wünscht, Sie hätten bereits gespeist und getrunken, bezahlt, ein ordentliches Trinkgeld hinterlassen und wären schon wieder auf dem Weg nach draußen. Sich das aber nicht anmerken zu lassen, das ist die Kunst des Bewirtens.
b. Operation: Tequila Sunrise
„Mist! Der Angostura-Bitter ist aus! Na dann nehmen wir eben die Worcester-Sauce – ist doch eh fast das gleiche Zeug.“
Barmann mit nach eigenem Bekunden 8jähriger Berufserfahrung bei der Zubereitung eines Manhattan-Cocktails
Die primäre und zugleich offensichtlichste Aufgabe eines Barmannes noch vor der Bewirtung ist es, Bestellungen anzunehmen und Getränke zuzubereiten. Das klingt nicht allzu kompliziert. Selbst einem dressierten Affen könnte man wohl mit einem gehörigen Maß Geduld eine Handvoll Cocktailrezepte beibringen – freilich mit schwankender Messgenauigkeit und unter fragwürdigen hygienischen Bedingungen, aber es wäre unbestreitbar möglich. Denken Sie nur an die faszinierende Gorilladame Koko, die sich mittels Gebärdensprache mit einem Repertoire von über 1.000 Zeichen verständlich machen kann und zudem annähernd 2.000 englische Wörter versteht. Sie würde sicherlich auch keine schlechte Barfrau abgeben und so manchen Kollegen mit Leichtigkeit in den Schatten stellen.
Aus diesem Gleichnis lässt sich schließen, dass es wohl für einen Menschen keine allzu überragende Leistung darstellen sollte, einhundert und mehr Rezepturen aus dem Stehgreif zu beherrschen. Gerne wird damit angegeben, man beherrsche 300 Rezepturen oder sogar noch weit mehr, aber was bedeutet das schon? Das bloße Auswendiglernen stellt an sich noch keine besondere kognitive Leistung dar, hierzu sind alle durchschnittlichen Geistesgrößen ohne allzu große Probleme fähig. Zudem haben Barmänner täglich mit der Zubereitung von Rezepten zu tun, die gängigsten davon prägen sich also schon aus purer Routine irgendwann wie von selbst ins Gedächtnis ein. Außerdem existieren sogenannte „Schlüssel-Rezepte“, die als Ausgangsbasis für weitere, lediglich leicht abgewandelte Rezepturen dienen. Hier ein einfaches und wohl nahezu jedem treuen Bargänger bekanntes Beispiel:
Grundrezept Caipirinha:
1 Limette (geachtelt)
3 Barlöffel Rohrzucker
5 cl Cachaça
gestoßenes Eis
Indem wir nun lediglich die Basis-Spirituose Cachaça austauschen, erhalten wir sodann folgende veränderte Cocktail-Bezeichnungen:
Rum = Caipirissima/Caipirumba
Wodka = Caipirovska/Caipiroska/Caipirodka
Aperol = Caipirol
Licor 43 = Caipi 43
Tequila = Caipiquila
Ginger Ale = Virgin Caipirinha/Ipanema
Als nächstes nehmen wir uns erneut die Grundrezeptur vor, fügen jedoch Minze hinzu, ersetzen die Cachaça durch Rum und fügen etwas Soda hinzu:
1 Limette (geachtelt)
Minze
3 Barlöffel Rohrzucker
5 cl Rum
2 – 3 cl Soda
gestoßenes Eis
Die so veränderte „Caipirinha“ erhält nun, im Gegensatz zu den ersten Abwandlungen, wo lediglich die Basis-Spirituose ausgetauscht wurde, eine vollkommen neue Bezeichnung: Mojito. Gehen wir nun noch einen Schritt weiter, entfernen wir die für die Caipirinha typischen Limetten, nehmen Bourbon-Whiskey anstelle der Cachaça und nutzen als Zucker entweder flüssigen Läuterzucker oder Puderzucker:
Читать дальше