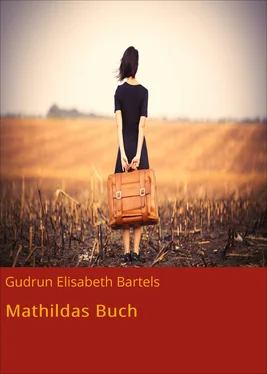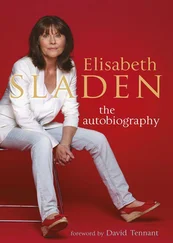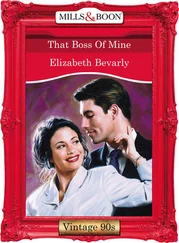Augenscheinlich tat ihr dieses Reden gut, dennoch bestand Emilia eines Tages darauf, mitzukommen. Marissa fühlte sich sichtbar unbehaglich dabei und wollte keines Falls mit ihr zusammen ins Sprechzimmer gehen.
Timo Schmidtmann war überrascht statt Marissa, Emilia eintreten zu sehen. „Geht es dir nicht gut“, fragte er. „Geht es Marissa nicht gut?“
„Uns geht es beiden gut“, beruhigte Emilia. „Ich möchte nur etwas wissen.“ Die Art, in der sie das sagte, machte den Arzt beklommen, doch er atmete dagegen an. „Marissa ist doch wieder gesund, warum soll sie dann so oft herkommen. Sie sagt, ihr redet. Wie kann ich das verstehen?“
Timo Schmidtmann fühlte sich irgendwie ertappt. Die Frage hatte in ihm das angesprochen, was er sich selber fragte. Die Frage nach der Berechtigung für diese Gespräche. Er war Allgemeinmediziner, kein Psychotherapeut. Er war in erster Linie für die körperlichen Beschwerden seiner Patienten zuständig, für Psyche und Seele waren andere da. Obwohl das eine vom anderen manchmal nicht so einfach zu trennen war. Recht erklären konnte er sich aber nicht, was ihn dazu gebracht hatte, Marissa diese Gesprächstermine vorzuschlagen. Er hatte wohl instinktiv geahnt, dass es für sie wichtig war, sich einiges von der Seele zu reden. Merkte an ihrer fortschreitenden Lockerheit, dass es ihr gut tat. Und merkte auch, dass es ihm gut tat. Dass er sich auf diese Termine freute. Vielleicht zu sehr. Er wusste um die Gefahr, die persönliche Gespräche für beiden Seiten in sich trug, von Gefühlen, die unwillkürlich auftauchen. Soviel hatte er von Psychologie im Studium mitbekommen. Das war aber auch das reizvolle daran und die Entdeckung einer neuen Welt in der Persönlichkeit des anderen. Und damit auch in sich selbst.
Emilia wartete auf eine Antwort. „Ich verstehe auf was deine Frage zielt“, sagte er schließlich. „Und ich muss sagen, ich bin dir dankbar. Wir reden, das ist richtig. Das heißt, meist ist es Marissa, die auf meine Fragen und Anregungen eingeht und dabei Dinge anspricht, die sie bewegen. Ich habe das Gefühl, dass es ihr gut tut, ihr ein Bedürfnis ist. Und doch – natürlich ist es von meiner Seite eine Kompetenzüberschreitung. Ich weiß, dass sie bei einem Therapeuten besser beraten wäre und möchte ihr für die Zukunft auch empfehlen, sich an einen qualifizierten Kollegen oder Kollegin zu wenden. Ich spüre da etwas in deiner Enkelin, dass sich klären muss. Und wahrscheinlich braucht sie dabei Unterstützung. Ich wollte ihr mit meinem Angebot zeigen, dass es möglich ist, dass sie Hilfe haben kann und sie annehmen sollte, wenn sie sich ihr darbietet. Mehr sollte es nicht sein.“
Timo Schmidtmann blickte Emilia offen an. Diese nickte. „Ich weiß, dass du es gut meinst. Und ich denke auch, dass sie Hilfe braucht. Sie ist ein empfindsames Wesen, das schon viel durchlebt hat. In ihrer und somit meiner Familie ist viel Leid und Unglück gewesen. Viele liebe Menschen sind vorzeitig von uns gegangen. In der weit zurückliegenden Vergangenheit aber auch in der jüngsten.“ Emilia hielt inne, schluckte an einem Kloß in ihrem Hals und an einem Brennen hinter den Augen.
„Ich weiß, dein Mann…“
Emilia schüttelte den Kopf. „Nicht nur. Julius ist friedlich eingeschlafen. Meine Trauer um ihn ist ruhig. Nein. Ich hatte noch eine Enkeltochter. Sandrina. Marissas Schwester. Sie ist letztes Jahr gestorben…“ Ihr Hals verschloss sich und die Stimme verstummte tonlos. Sie atmete schwer in sich hinein, sah den mitfühlenden Blick des Arztes. „Ich fürchte, Marissa hat das noch lange nicht verwunden. Sie ist sehr bedürftig nach Zuwendung. Bitte gib Acht.“
„Danke, Emilia. Danke für deine offenen Worte. Und sei gewiss, dass ich achtsam bin und mit euch fühle. Ich weiß nicht, wie eure Familie mit diesem Schmerz umgeht, ob ihr darüber sprecht… aber das ist wichtig, redet miteinander. Rede mit Marissa. Sie braucht das.“ Er blickte sie nachdrücklich an. „Sie hat Vertrauen zu dir und liebt dich, sonst wäre sie nicht zu dir gekommen. Nutze das für euer beider Wohl, für das Wohl eurer Familie. Manchmal ist es leichter mit einem Fremden darüber zu sprechen doch es ist auch hilfreich sich den Nahestehenden zu öffnen. Ihr braucht euch alle. Sonst seid ihr allein und einsam. Geht aufeinander zu, dann wird vieles leichter.“
Emilia nickte nachdenklich, stand auf und trat zu dem Mediziner, der hinter dem Schreibtisch aufgestanden war. „Laß es dir gefallen“, sagte sie als sie mit den Händen seinen Kopf umfasste und zu sich auf ihre Höhe hinunterzog. Ihre Lippen berührten leicht seine Stirn. „Du hast mir sehr geholfen.“
Timo Schmidtmann verzog sein Gesicht zu diesem unwiderstehlichen jungenhaften Grinsen. „Mensch, Emilia – wenn ich nicht zu jung für dich wäre, müsste ich mich wahrlich in Acht nehmen.“ Er griff ihre Hand und hauchte einen Kuss darauf. „Ihr seid schon war besonderes, du und deine Enkelin.“
*
Auf dem Nachhauseweg waren beide sehr schweigsam. Marissa hatte ihre Großmutter kaum angesehen nachdem diese aus dem Sprechzimmer gekommen war und sie selber für ein paar Minuten hineinging. Keine von beiden sagte der anderen, was der Arzt mit ihr gesprochen hatte. Es war wie eine stille Übereinkunft, der Anderen Raum für Gedanken zu lassen. Ordnung in sich zu finden und Klarheit darüber, wie mit dem Erfahrenen umzugehen sei.
Sie fuhren langsam mit den Rädern nebenineinander her, ließen die Inselvegetation an sich vorübergleiten wie in einem Zeitlupenfilm, jede in sich versunken, fern von hier. Getragen von Empfindungen voller Widersprüche. Mit einem Mal jedoch beschleunigte Marissa das Tempo, sodass Emilia Mühe hatte hinterherzukommen. Immer schneller und schneller wurde sie, bis sie Emilia weit hinter sich gelassen hatte und diese Marissa nur noch als Bewegung am Ende des Weges erkennen konnte. „Fahr nur“, sprach Emilia vor sich hin in den Fahrtwind, der ihr die Augen tränen ließ. „Es ist gut.“
Marissa hatte keine Ahnung, was sie zu dem impulsiven Davonbrausen getrieben hatte. Wie von selber waren ihre Beine immer heftiger in die Pedale getreten, immer schneller und schneller, sodass sie das Gefühl hatte, sie müsse gleich davonfliegen. Weg von hier, weg von sich selber, weg von diesem Gedankengewimmel in ihrem Kopf, das sich nicht entwirren wollte, ihr nicht klar erscheinen ließ, was das alles zu bedeuten hatte. Dieses Gespräch vorhin in der Praxis. Dieses Ziehen in ihrem Inneren und das klopfende Stolpern in der Herzgegend. Sie musste es ganz schnell hinter sich lassen. Alles vergessen, vom Wind verwehen, vom Wasser wegspülen, von der Sonne verbrennen lassen. Aus ihr heraus löste sich ein Schrei gegen die dumpfe Enttäuschung, gegen den Schmerz, gegen die Erinnerung. Die an das Heute und die an das Gestern.
Sie fuhr stehend eine Wegsenkung hinunter, lehnte sich über den Lenker und schrie sich frei. Mit quietschenden Bremsen fuhr sie den Weg zum Haus der Großmutter hin, ließ das Fahrrad achtlos am Zaun stehen und rannte hinüber zu den Dünen, weiter hin zum Meer, das sie mit lauter Brandung empfing. Sie stoppte sich erst als das Wasser ihr schon bis zu den Knien reichte und sie keine Luft mehr hatte, gegen das Tosen des Meeres anzubrüllen.
*
Emilia dachte noch über die Worte des Arztes nach. Reden. Reden war heilsam. Natürlich wusste sie das, aber so wie in ihrer Familie von jeher nicht viel gesprochen worden war, war auch sie nicht unbedingt diejenige, die viel über das sprach, was sie bewegte. Eher war sie diejenige, die anderen zuhörte, anderen mit Rat zur Seite stand oder einfach nur da war, wenn sie gebraucht wurde. Schon in der Schulzeit war sie die beste Freundin bei Herzschmerz gewesen und in den schweren Krieg- und Nachkriegsjahren diejenige, die anderen Mut und Zuversicht vermittelte. Half mit Worten und Taten und stellte sich selber ganz hinten in die Reihe der Bedürftigen. Dabei drängte sie sich anderen nie auf, wartete bis diese zu ihr kamen und die Lasten vor ihr abluden. Säcke voll mit Tränen, Kummer und Leid. Zu viele manchmal, um sich dann noch den sorgsam verschnürten Seelenpakete der eigenen Familie zu widmen. Von ihren ganz persönlichen ganz zu schweigen.
Читать дальше