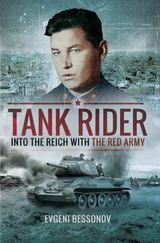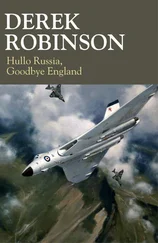„Nummer Sicher“ heißt: Intensivstation – Stroke Unit. Vollverkabelung, Heparin-Tropf. Ich stehe bzw. liege ab jetzt irgendwie neben mir. Alles passiert wie im Film, den ich nur stumm beobachte. Immerhin funktionieren die Augen wieder fast einwandfrei.
In dieser Nacht schlafe ich nicht. Die Stroke Unit befindet sich unterm Dach des alten Klinik-Gemäuers. Draußen stürmt und gewittert es. Durch die drei quadratischen Fenster hab‘ ich ’nen tollen Panoramablick in die von Blitz und Donner verquirlten Wolken. Überall pfeift der Wind durchs Gebälk. Die Schiebetür zum Nachbarzimmer schlägt in den Führungsschienen hin und her. Ich stelle mir vor, ich wäre auf der Pequod, dem Schiff, auf dem Kapitän Ahab hinter Moby Dick, dem weißen Wal, herjagt. In Herman Melvilles Roman geht das Schiff unter … alle saufen ab - bis auf einen: Ismael. Der will ich sein.
Am nächsten Morgen geht es weiter mit diversen Untersuchungen: EEG, Blutuntersuchung, Herzlabor und Langzeit EKG. Danach darf ich mit einer Dauer-Heparin-Infusion auf ein normales Zimmer.
Wer schon mal auf der Neurologie lag, stellt schnell fest, dass hier die Uhren anders ticken. Ein Universum für sich, denn hier treffen sie sich: die Grenzfälle menschlichen Bewusstseins. Ich bin mittendrin. Genauso grenzwertig bewusst unterwegs wie alle anderen.
Nach meinem Debüt in der Stroke Unit letzte Woche liege ich jetzt seit vier Tagen mit meinem Höllen-Schwindel auf Zimmer Nr. 6 mit Linda und Michaela. Linda hat Epilepsie und diverse psychische Probleme. Zwischen uns liegt völlig apathisch Michaela: eine altersmäßig schwer schätzbare Patientin mit Downsyndrom, die zwar nicht sprechen, aber sehr laut brummen kann.
Rund um die Uhr stößt sie unvermittelt Schreie aus, die sich anhören wie ein balzender Pfau. Ich rede mit ihr, wenn sie Pfauenlaute macht. Sage ihr, dass alles gut ist. Beruhige damit in Wirklichkeit mich selbst. Ich habe keine Ahnung, ob Michaela mich versteht. Auf jeden Fall sieht sie mich an, hört auf zu schreien und brummt wieder. Manchmal lächelt sie, wenn ich mit meinem grünen Plüsch-Frosch, den mir mein Sohn zur Unterstützung mit ins Krankenhaus gegeben hat, ihr rosa Frottee-Schaf anstupse und dabei „Hallo“ sage. Ich mag Michaela, aber unsere Beziehung wäre schöner, wenn sie leiser wäre – oder ich taub.
Wenn Linda nicht gerade in einem seltsam weggetretenen Zustand ist (liegt an den Medikamenten, sagt sie), kann man sich sehr gut mit ihr unterhalten. Sie ist gebildet, witzig und lebenserfahren. Ich erschrecke ein bisschen, als sie mir erzählt, dass sie sich selbst unter Betreuung stellen lassen möchte. Sie kriegt nichts mehr geregelt und hat niemanden, der ihr helfen kann, sagt sie. Mehrmals. Ohne jede erkennbare Gefühlsregung. Liegt auch an den Medikamenten, denke ich. Nicht mal Wechselklamotten bringt ihr jemand vorbei. Von ihr höre ich zum ersten Mal von einem Medikament namens Topiramat. Sie warnt mich eindringlich davor. Das hätte sie total kaputtgemacht. Ihre Warnung vergesse ich nicht.
Nachdem sie mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählt hat, bin ich mir sicher: Wenn ich mich nicht sehr schnell und sehr gewissenhaft um meine Probleme kümmere, wird genau DAS meine Zukunft sein: weitere Medikamenten-Experimente, psychiatrische Einrichtungen, kompletter Autonomie-Verlust, totaler Zusammenbruch: Good bye Familie.
Nach meinem ersten längeren Gespräch mit Linda hatte ich meinen Psychotherapeuten angerufen und ihm meine Lage und die damit verbundenen Sorgen geschildert. Er beruhigt mich. Ich hätte genug Werkzeug, um jetzt hier im Krankenhaus erst mal klarzukommen, und dann würden wir weiter schauen. Ich verlasse mich auf seine Einschätzung und gehe stoisch meine Übungen und Werkzeuge durch: Akupunktur-Ring zur Fokusumlenkung bei aufsteigender Angst, Pika-Pika-Atmung, Hypnose-App, Schmetterlingsumarmung, breitbeiniger Gang bei Unruhe. Hier falle ich damit sowieso nicht unangenehm auf. Unbestaunt gehe ich sechs Mal täglich die Treppen hoch und runter und zwanzig Mal den Gang auf und ab, um meine Venenklappen und mein Gleichgewichtsorgan nicht ganz zu vernachlässigen.
„Weißkittelhypertonie“: dem Trauma auf der Spur
Am vorletzten Morgen in der Klinik habe ich ein Schlüsselerlebnis: Seit ich denken kann, habe ich panische Angst vorm Blutdruckmessen. Allerdings nur beim Arzt oder wenn jemand zuschaut. Unwillkürlich höre ich auf zu atmen. Will nur, dass es schnell vorbei ist. Regelrechte Panik habe ich, wenn die Manschette um meinen Arm gelegt und langsam enger wird. Außerdem tut es wahnsinnig weh und hinterlässt blaue Flecken auf meinen Oberarmen. Wie hoch die Werte in dieser Paniksituation sind, kann man sich vorstellen.
Sämtliche Langzeitmessungen, Eigenmessungen mit geeichten Geräten und Messungen von Vertrauenspersonen zeigen normale Werte (außer eben in Paniksituationen). Heute weiß ich, dass es sogar Fachausdrücke für meine Probleme gibt: „Weißkittelhypertonie“ (Bluthochdruck beim Arzt) und Iatrophobie (Arztangst). Doch, woher kommt so etwas?
Auf die Spur der möglichen Ursache bringt mich der Anästhesie-Pfleger Stefan bei den Vorbereitungen für eine Magenspiegelung. Hier im Krankenhaus könne man sich doch auch gleich mal meinen Magen ansehen, der mich seit Monaten ärgert und den ich auf Anraten des TCM-Internisten dauerhaft mit Protonenpumpenhemmern (Magensäureblockern) ruhigstellen soll, fand der Neurologe. So lag ich jetzt in meinem kurzen OP-Hemd auf der Spiegelungspritsche und scherzte mit Stefan über Propofol und Michael Jackson. Ich weise noch fröhlich darauf hin, dass ich am gleichen Tag Geburtstag habe wie der King of Pop. Der soll ja die „Schlafmilch“, wie Pfleger Stefan das Narkosemittel nennt, von seinem verantwortungslosen Arzt bekommen haben, weil er das Entspannungsgefühl beim Wirkungseintritt so toll fand. Die Stimmung ist gelöst - bis er mit der Blutdruck-Manschette ankommt. Ich krieg‘ den „irren Blick“, sage, dass ich Angst vorm Blutdruckmessen habe und lieber am offenen Herzen operiert werden würde als das jetzt mitmachen zu müssen.
Anstatt mich zu belächeln und mit einem „Ach, was!“ loszulegen, wie die meisten Pfleger, Krankenschwestern und Ärzte vor ihm, sagt er: „Das ist ja interessant. Hab‘ ich ja noch nie gehört. Haben Sie denn mehr Angst vor dem Messen oder mehr Angst vor dem Ergebnis?“
Gute Frage, Pfleger Stefan!
„Ich weiß gar nicht“, sage ich, behalte die Frage aber im Hinterkopf und hoffe, dass ich mich nach der Narkose noch daran erinnere. „Das Ergebnis ist natürlich immer zu hoch. Hab‘ ja Panik. Dann fühl‘ ich mich falsch verurteilt und doof. Irrational, ich weiß“, schwadroniere ich vor lauter Angst weiter. Der Doc kommt dazu. Ich will mich nicht anstellen und cool sein - klappt aber nicht. Ich fange an zu zittern und zu weinen. Jetzt habe ich noch mehr Angst. Vor der Reaktion des Arztes. Der guckt verwundert zu Pfleger Stefan herüber. Dieser erklärt sachlich:
„Sie hat Angst vorm Blutdruckmessen.“ Oberpeinlich!
„Ach“, sagt der Doc (jetzt kommt’s wieder, denke ich).
„Dann machen wir Ihnen das einfach gleich um, wenn Sie schlafen.“
Thema durch. Ich bin etwas verdutzt, aber sofort maximal entspannt. Auch ohne Propofol. Wenn doch nur alles so einfach wäre. Als ich wieder wach werde, habe ich noch die Manschette um den Arm. Pfleger Stefan sitzt neben mir an einem Tisch und sortiert Unterlagen. Als er merkt, dass ich wach bin, zwinkert er mir zu: „Na, da sind sie ja wieder. Blutdruck is‘ noch’n bisschen niedrig, aber sonst is‘ alles ok.“ Niedrig, wundere ich mich. Aber ein Wunder ist es ja nicht. Schließlich hat mich die Schlafmilch direkt vom Arztkontakt ins Neverland verfrachtet.
Mittlerweile weiß ich, dass meine Blutdruck-Mess-Angst mit meiner komplexen posttraumatischen Belastungsstörung (komplexe PTBS) zusammenhängt. Es ist nichts anderes, als die Angst, Inneres preiszugeben, Befindlichkeiten zu äußern und Bedürfnisse zu haben. Jahrzehnte lang wurde ich von meinen Eltern (teilweise mit physischer aber vor allem mit psychischer Gewalt) bestens darauf trainiert und konditioniert, alles, was meine Bedürfnisse oder emotionalen Anteile angeht, zu verdrängen, abzuspalten oder zu verleugnen.
Читать дальше