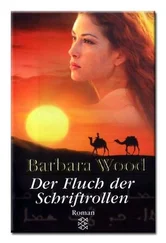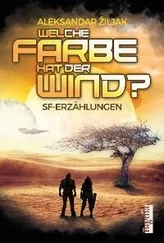„Hi Thomas, wie weit seid ihr heute gekommen?“ Malcolm wandte sich an einen der beiden, als er von seinem Pferd abstieg. Der Angesprochene hielt an, reichte seinem Partner seinen Eimer und antwortete:“ ich denke noch zwei Tage, dann haben wir sie alle zusammen. Wir haben heute eine große Anzahl hereinbringen können.“
„Gut, dann kommen wir gut voran. Wir müssen allerdings auch auf die Ostweide. Wir haben heute etliche Tiere dort gesehen.“
„Ok, vielleicht schaffen wir das morgen schon. Wie war es heute bei dir?“ Mit einer Kopfbewegung zeigte er in Chágha thos Richtung, der sich schon daran gemacht hatte, Malcolms Pferd zu versorgen und auf das Paddock zu den anderen zu schicken. Nun nahm er sein Pferd, band es an einen Holzpflock und wollte gerade im Stall verschwinden, als er aufhorchte. Ein metallisches Klirren war vom Haupthaus zu vernehmen. Verdutzt sah er Malcolm an, der ihm nur entgegnete:“ Das ist die Essensglocke. Abendessen ist fertig. Die Mahlzeiten verbringen wir gemeinsam im Haus drüben. Beeil Dich und komm dann rüber.“ Er wandte sich zusammen mit Thomas ab und ging in Richtung Haupthaus. Auch der dritte Mann folgte ihnen. Chágha tho blieb alleine zurück. Im Nachbargebäude öffnete sich die Tür und er beobachtete, wie die restlichen Cowboys lachend und in Gesprächen vertieft sich auf den Weg zum Haus machten.
Bald darauf war es still. Die Männer waren im Haus verschwunden und auch er machte sich auf den Weg in den Stall. Überrascht stellte er fest, dass in seiner Abwesenheit frische Strohballen in eine Ecke gebracht worden und mit weißen Laken drapiert worden waren, sodass es ein einladendes Nachtlager nun war. Dazu hatte jemand ihm eine Waschschüssel, Handtuch und Seife gelegt. Das musste Isabella gewesen sein, ein eindeutig weibliches Zeichen, ging es ihm durch den Kopf.
Er schnappte sich Handtuch und Seife und ging wieder zu seinem Pferd hinaus. Dort schnappte er sich die Zügel, schwang sich auf den Rücken des Tieres und galoppierte davon. Heute Abend würde er nicht mit den Anderen essen, sein Gefühl sagte ihm, dass es noch zu früh dafür sei und so beschloss er zum Fluss zu reiten, um ein ausgiebiges Bad zu nehmen und dort sich sein Abendessen zu besorgen.
Im Haus war es plötzlich still am Tisch geworden. Jeder hatte das davon galoppierende Pferd vernommen. Sofort hatten die Männer alles Stehen und Liegen gelassen und waren zur Tür geeilt. In der Dunkelheit konnten sie nur noch die Umrisse des einzelnen Reiters ausmachen, bevor er von der hereinbrechenden Nacht verschluckt wurde.
„Das war der Indianer, verflucht noch einmal. Jetzt reitet er bestimmt zu seinen Leuten und wir sitzen hier ahnungslos beim Essen.“ Carl warf wütende Blicke auf James, der hinter ihm stand.
Die Veranda war voller Männer, die nun etwas ängstlich ihren Boss anschauten und darauf warteten, dass er etwas unternahm. Auch Isabella war neugierig nach draußen gekommen. Nun wandte sich James an Thomas und meinte:“ reite ihm hinterher. Er ist in Richtung Fluss geritten. Gib Bescheid, was er da macht, aber halte Abstand und lass dich nicht erwischen. Ich will nicht, dass er merkt, dass wir ihm folgen.“
„Ok, Boss.“ Thomas rannte hinüber zum Paddock und es dauerte nicht lange, da preschte er an ihnen vorbei. Ein jeder beobachtete, wie er in derselben Richtung wie der Indianer verschwand.
„So und wir gehen jetzt wieder rein. Isabella hat gut gekocht und das wollen wir nicht verkommen lassen.“ Er ging an Carl und den anderen vorbei zurück ins Haus. Die meisten folgten ihm. Carl und noch zwei weitere Männer blieben vor der Tür stehen und schauten noch weiter in die Richtung, wo ihr Mann verschwunden war.
„Hab ich es euch nicht gesagt. Die Rothaut wird Unheil über uns bringen. Wenn wir da nicht was unternehmen, werden wir früher tot sein, als uns lieb ist.“
„Jetzt warte erst einmal ab, Carl. Der Boss wird schon das Richtige tun.“
Mit einer abfälligen Handbewegung und Bemerkung ging Carl wieder ins Haus hinein und die beiden anderen folgten ihm. Isabella, die in der dunklen Ecke der Veranda gestanden hatte, machte ein besorgtes Gesicht. Carl fing an, die Arbeiter gegen Chágha tho aufmischen zu wollen. Einerseits konnte sie die Männer verstehen. Was hatte der Indianer vor?
Warum war er jetzt im Dunkeln noch weggeritten und wohin? Andererseits konnte sie, oder besser gesagt, wollte sie nicht glauben, dass er etwas Böses im Schilde führte. Wenn er es wollte, hätte er die Gelegenheit schon längst gehabt. Trotzdem konnte sie sich nicht vorstellen, wohin er unterwegs war. Es fröstelte sie. Die Nächte kühlten noch schnell ab und sie hatte sich keine Jacke übergezogen. Nun fing sie an, in ihrer dünnen Bluse zu frieren und ging deshalb wieder hinein.
Er wusste, er war nicht allein, doch von dem Beobachter ging keine Gefahr aus. Sie hatten ihm jemanden hinterher geschickt, weil sie ihm nicht vertrauten. Einerseits ärgerte es ihn, andererseits konnte er die Handlungsweise nachvollziehen. Der junge Mann, der in den Büschen hinter im steckte und ihn beobachtete, hatte versucht sich unbemerkt an ihn heranzuschleichen, doch er musste noch viel lernen. Noch bevor er hier am Fluss angekommen war, hatte er gemerkt, dass er verfolgt wurde. Er wusste auch, wer sich dort hinter den Bäumen versteckte. Malcolm hatte ihn, Thomas genannt und er hatte ihn vor dem Stall kennen gelernt. Er mochte ungefähr in seinem Alter sein.
Wenn er es darauf anlegen wollte, könnte er dem Mann schneller die Kehle durchschneiden, als er es merken würde, dachte er so bei sich und sammelte weiterhin ein paar Äste für ein Feuer zusammen. Sein Pferd graste friedlich, während er sich ein kleines Lagerfeuer direkt am Flussufer entzündete. Es dauerte nicht lange, bis das Feuer gut brannte. Schnell zog er seine Mokassins aus und entledigte sich seines Hemdes und der Hose. Er balancierte auf den nassen Steinen am Ufer entlang, bis er die tiefe Stelle des Flusses erreicht hatte. Dann tauchte er mit seinem ganzen Körper in die eisige Flut hinein.
Durch die Kälte des Wassers fühlte sich sein Körper an, als würde er mit tausend kleiner Nadelstiche übersät werden. Er zog tief die Luft ein und begann mit kräftigen Zügen zu schwimmen. Je weiter er zur Mitte des Flusses schwamm, umso stärker wurde die Strömung. Doch er war ein guter und kraftvoller Schwimmer und so reichten ihm ein paar wenige gezielte Schwimmzüge und er war auf der anderen Seite des Flusses angekommen. Dort verharrte er ein wenig im Wasser. Sein Körper fing an, sich an die Temperatur zu gewöhnen.
Er war erfahren und abgehärtet genug, um zu wissen, wie lange er seinen nackten Körper diesen Temperaturen aussetzen konnte. Honiahake und er hatten früher oft in der Nacht in den Seen und Flüssen gebadet. Auch im Winter hatten sie kurze Bäder genommen, um ihr Kräfte zu stärken. Unter ihnen hatte es immer einen
kleinen Konkurrenzkampf gegeben. Wer von ihnen besser reiten, jagen oder fischen konnte. Oder in diesem Fall besser schwimmen und tauchen konnte. Das Kräfteverhältnis war zwischen ihnen ausgeglichen gewesen. Mal hatte er gewonnen, mal war es Honiahake gewesen. Sie hatten es beide gemocht,
diese kleinen Wettkämpfe untereinander auszutragen. Er vermisste ihn. In den Wochen, die er jetzt schon alleine unterwegs war, wurde ihm immer klarer, wie sehr er sich danach sehnte, wieder bei ihnen zu sein. Wie gerne würde er wieder mit den anderen Kriegern am Lagerfeuer sitzen und auf die Jagd gehen.
Die Kälte, die nun von ihm Besitz ergriff, holte ihn aus seinen Gedanken zurück in die Gegenwart. Er blickte hinüber auf die andere Fluss-Seite, wo das wärmende Feuer brannte und sein Pferd halb im Wasser stand und trank. Kurz tauchte er unter, um seinen Kopf wieder frei zubekommen und schwamm dann wieder zurück. Wenig später saß er mit nacktem Oberkörper am Feuer, um sich aufzuwärmen.
Читать дальше