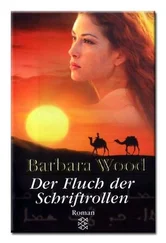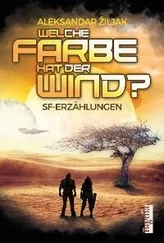Nun ging die Tür auf und James trat zu ihnen dazu. In Gedanken versunken ging er an ihnen vorbei und stützte sich auf der Holz Balustrade ab. Sein Blick ging hinüber zur Scheune. Isabella hielt mit ihrer Stopfarbeit inne und schaute ihren Großvater an, sagte aber nichts. Dieser machte ein nachdenkliches Gesicht. Als James sich umdrehte und mit dem Rücken an dem Geländer lehnte, richtete der Großvater das Wort an ihn.
„Ich hoffe, du hast heute keinen Fehler gemacht. Der Junge wird Ärger bringen.“
James massierte seinen Nacken. „Ich weiß, aber sie werden es schon schlucken.“
„Bist du dir da sicher? Carl wird keine Ruhe geben. Er ist stur und uneinsichtig.“
„Ja leider.“
„Du weißt, dass Carl seine Ranch, seine Frau und seine kleine Tochter bei einem Indianerüberfall verloren hat?“
„Ja, das weiß ich, aber das ist jetzt über zwanzig Jahre her. Irgendwann muss man auch mal verzeihen und vergessen können und der Junge war da noch gar nicht geboren.“
„Carl hat das nie überwunden. Er hasst die Indianer abgrundtief, und damit, dass du ihn hierher gebracht hast, wird die Sache nicht besser.“
„Ich weiß, Vater. Aber im Moment ist das die beste Lösung. Ich weiß nicht, was er im Schilde führt und ich habe ihn besser hier unter Kontrolle, als das er mir jeden Tag um die Ranch herumschleicht und alle nervös macht. Da kann ich keine Rücksicht auf die Gefühle von Carl nehmen, wenn es um die Ranch geht. Wir müssen herausfinden, warum er wirklich hier ist und das können wir am Besten, wenn er in unserer Nähe ist. Malcolm wird sich seiner annehmen, da er der Einzige ist, der sich mit ihm unterhalten kann und dann werden wir sehen, wie schnell er unsere Sprache lernt.“
„Vielleicht hast du Recht.“ William zog wieder an seiner Pfeife.
Isabella, die das Ganze schweigend mit angehört hatte, meinte nun zu ihrem Vater: „Ich kann ihm ja Sprachunterricht geben.“
Bedrohlich richtete der Vater seinen Zeigefinger auf seine Tochter und antwortete in einem schärferen Ton als beabsichtigt, was Isabella etwas verschreckt zurückfahren ließ.
„Du mein junges Fräulein hältst dich da raus. UND - Du hältst Abstand von diesem Indianer. Ich möchte dich nicht in seiner Nähe sehen. Sollte es hier Probleme geben, dann möchte ich dich nicht zwischen den Fronten stehen sehen. Habe ich mich da klar ausgedrückt?“
„Ja, Vater,“ verärgert und enttäuscht erhob sie sich. „Ich bin müde. Gute Nacht,“ damit erhob sie sich, nahm ihre Sachen und ging ins Haus.
William sah seinen Sohn an.
„War das nötig, ihr so die Leviten zu lesen?“
„Besser sie weiß gleich Bescheid, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommt. Sie ist manchmal so stur, wie ihre Mutter es war.“
William lachte. „Und du hast sie abgöttisch geliebt.“
„Ja, gute Nacht Vater.“
„Gute Nacht, mein Sohn.“
Der Schatten, der an der Außenwand der Scheune lehnte und zum Haus hinüber blickte, hatte die Szene beobachtet. Er hatte schon eine ganze Weile dort gestanden und im Schutz der Dunkelheit die Bewegungen auf der Veranda mit verfolgt. Nun sah er, wie Isabella ins Haus gegangen war und wenig später im ersten Stock ein Zimmer von einem Lichtschein erhellt wurde. Das war also ihr Zimmer. Er konnte sehen, wie sie sich im Zimmer hin und her bewegte. Inzwischen waren der Vater und der Großvater ebenfalls im Haus verschwunden. Die Lichter waren unten gelöscht worden und in einem weiteren Fenster im ersten Stock war ein kleiner Lichtschein zu erkennen. Dieser Lichtstrahl drang nicht so hell zu ihm hinaus, weil dort bereits Vorhänge vor dem Fenster hingen.
Die Bewohner schienen sich zur Nachtruhe zu begeben. Nun konnte er beobachten, wie Isabella direkt ans Fenster kam. Doch anstatt ihre Vorhänge zuzuziehen, stand sie bewegungslos davor und blickte direkt auf ihn nieder. Etwas verdutzt zog er sich weiter in die Dunkelheit zurück.
Er kniff seine blauen Augen zusammen und überlegte, ob sie ihn sehen konnte, entschied sich dann aber dafür, dass ihr Blick nur zufällig in seine Richtung gegangen war. Als er wieder zu ihr hinauf blickte, war sie am Fenster verschwunden und hatte die Vorhänge vorgezogen. Er blickte sich noch einmal um, sah das auch in den anderen Hütten die Lichter ausgingen und ging dann selber wieder hinein in den Schober.
In einer Hütte brannte aber noch Licht und die Bewohner waren noch in einer heftigen Debatte.
„Leute, wir können das nicht zulassen. Der Boss muss den Verstand verloren haben. Eine Rothaut auf unserer Ranch. Er wird uns an seine Leute verraten. Wird hier alles ausspionieren und dann werden sie uns überfallen.“
„Carl, ich glaube, jetzt übertreibst du. Wir wissen doch, dass er allein ist. So schlimm wird es nicht werden.“
„Das sagt Ihr jetzt, weil Ihr sie nicht kennt. Ich kenne diese Bastarde genug. Weiss, wie sie vorgehen und ich sage euch, er ist der Teufel in Person. Wir sollten das nicht zu lassen.“
„Was hast du vor?“
„Ich weiß es noch nicht, aber wir sollten es nicht so einfach hinnehmen, dass er hier ist.“
„Der Boss hat sich klar darüber ausgesprochen, dass der Indianer hier Gast ist. Das sollten wir akzeptieren. Ich will meine Arbeitsstelle hier nicht verlieren. Es ist eine gute Arbeit und wird gut bezahlt.“
„Genau!“ stimmten die anderen mit ein. Nur Carl entgegnete ihm: „Ja habt ihr es immer noch nicht kapiert. Der Boss handelt aus falschen Beweggründen. Der Dreckskerl hat seine Tochter gerettet und nun meint er, er wäre der Rothaut was schuldig. Das Einzige, was man diesen roten Kerlen schuldig ist, ist das man sie am nächsten Baum aufknüpfen sollte.“
„Man Carl, lass das keinen hören. Du hast doch nicht etwa vor ihn zu beseitigen?“
Carl merkte, dass die anderen Cowboys nicht Manns genug waren, um ihm bei seinem Vorhaben zu helfen, und ruderte deswegen etwas zurück.
„Nein, natürlich nicht. Ich habe nur meinem Ärger ein bisschen Luft gemacht.
Wenn wir Glück haben, wird er uns ja nicht in die Quere kommen, da sich Malcolm mit ihm befassen wird. Es ist spät geworden, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht Jungs.“
Die Andern schienen beruhigt zu sein, dass sich Carl wieder gefangen hatte, und begaben sich ebenfalls zur Ruhe. Carl hingegen dachte gar nicht daran, seinen Plan aufzugeben. Er würde den Bastard beobachten und vielleicht würde sich die Gelegenheit ergeben, dass er sich an ihm rächen konnte. Unfälle passierten schließlich jeden Tag und nur ein toter Indianer, war ein guter Indianer.
Die Sonne war noch nicht ganz aufgegangen, als Malcolm in den Stall kam. Er wollte gerade Chágha tho wecken, als er sah, dass sein Nachtlager leer war. Etwas verdutzt blickte er sich um, sah aber nur das Pferd des Indianers friedlich in seiner Ecke stehen. Wo war er nur? Malcolm ging durch die hintere Tür ins Freie und versuchte in der Dämmerung ihn irgendwo zu sehen. Plötzlich tauchte er wie aus dem Nichts neben ihm auf. Malcolm fasste sich ans Herz und stieß einen erschreckten Laut aus. „Junge, du kannst einen alten Mann wie mich doch nicht so erschrecken.“ Chágha tho grinste achselzuckend und ging dann zurück in den Stall.
Malcolm hingegen schüttelte den Kopf und meinte zu sich selbst: „Worauf habe ich mich da bloß eingelassen.“
Wenig später waren beide mit Ihren Pferden unterwegs und Malcolm fing an, Chágha tho die Ranch zu zeigen. Zuerst ritten sie an der westlichen Begrenzung entlang und Malcolm hielt von Zeit zu Zeit an, um dem Indianer zu zeigen und zu erklären, wie man Zäune ausbesserte und warum. Erst übersetzte er und dann wiederholte er es in Englisch noch einmal, sodass Chágha tho die Worte lernen konnte.
Der Junge schien schnell zu begreifen, denn es dauerte nicht lange, da konnte er die nötigen Handgriffe schon allein und Malcolm musste überrascht feststellen, dass er einen wissbegierigen Schüler hatte. Zum Mittag machten sie Pause an einem kleinen Fluss, der durch das Gelände der Ranch floss.
Читать дальше