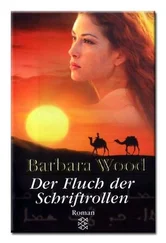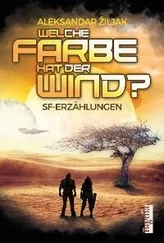1 ...8 9 10 12 13 14 ...17 „Du meinst also, es geht von ihm keine Gefahr aus?“
„Jedenfalls nicht die, an die wir denken. Es wird keinen Angriff geben und wir dürften uns so sicher wie bisher fühlen.“
„Was sollen wir dann also deiner Meinung nach tun?“
„Ich würde ihn laufen lassen. Er hat nichts Unrechtes getan und die Armee sieht es nicht gerne, wenn es diesbezüglich Probleme gibt.“
„Ja, da hast du wahrscheinlich Recht. Lassen wir ihn noch ein bisschen schmoren und morgen Früh, kann er gehen.“
„Ok, Boss. Ich rede morgen mit ihm.“
„Und, was hat er gesagt Vater? Habt ihr was erfahren?“ Isabella stürmte sofort auf ihren Vater zu, als dieser zur Haustür hereinkam.
„Er ist Cheyenne, wie Malcolm es schon vermutet hatte und er ist alleine, ohne seinen Stamm hier. Malcolm denkt, dass er so eine Art Mutprobe von seinem Stamm aus machen muss und deswegen so weit weg von seinen eigenen Leuten ist. Morgen kann er gehen.“ James ging zu Louisa in die Küche und nahm die heiße Kaffeekanne vom Herd. Mit einem gefüllten Becher setzte er sich an den Esstisch.
Isabella umarmte ihren Vater, drückte ihm einen Kuss auf die Wange und verschwand dann wieder in der Küche um Louisa weiter zu helfen. James hingegen war sich nicht sicher, ob seine Entscheidung richtig war. Irgendetwas schien in zu stören, doch er wusste nicht genau, was es war.
Die Sonne war noch nicht richtig aufgegangen, als Malcolm zu Chágha tho in den Stall kam. Die beiden Wachen standen am Eingang und begrüßten ihren Mann.
„Ihr könnt zum Essen ins Haus gehen. Der Indianer darf gehen.“
„Ok, der hat die ganze Nacht kein Auge zu getan. Saß nur in der Ecke und hat uns angestarrt. Recht unheimlich war das.“
„Hat er noch irgendetwas gemacht?“
„Nein, er war friedlich. Sein Pferd nebenan war es auch.“
„Ok geht und stärkt euch. Nachher haben wir wieder alle Hände voll zu tun, nachdem wir fast zwei Tage die Arbeit liegen lassen mussten.“
Die Männer machten sich auf den Weg und Malcolm setzte seinen Weg fort in Richtung des Indianers. Bei der Box seines Pferdes machte er Halt. Es stand noch, mit dem indianischen Halfter am Kopf, in der Box und fraß Stroh. Die Waffen des Indianers, sein Messer und Pfeil und Bogen lagen davor. Jetzt nahm er diese Sachen in die Hand und ging zu der letzten Box, in der Chágha tho immer noch genauso auf dem Boden saß, wie er ihn gestern Abend verlassen hatte.
Wenn der Indianer irgendwelche Emotionen ihm gegenüber hatte, konnte man es ihm nicht anmerken. Es war, als würde er durch ihn hindurchsehen. Nichts regte sich im Körper oder im Gesicht des Mannes. Malcolm blieb in der Öffnung stehen und sprach ihn an.
„Hier sind deine Waffen, du kannst gehen.“ Er hielt ihm die Sachen entgegen, doch der Indianer blieb still sitzen. Malcolm wollte schon den Satz wiederholen, als der Mann ihm entgegnete: „Warum?“
„Warum? Nun, du hast nichts getan. Du bist frei.“
„Chágha tho hat vorher auch nichts getan und trotzdem wurde er gefangen genommen. Warum ihn also jetzt laufen lassen? Weiße und Indianer sind keine Freunde.“
Malcolm kratzte sich am Hinterkopf, stellte die Waffen neben sich an die Wand und setzte sich dem Mann gegenüber. Der Indianer wollte also ein paar Erklärungen haben.
„Weiße und Indianer haben ihre Differenzen. Ja, aber wir sind friedlich. Leben hier schon lange ohne Probleme zu haben. Der Vater hat Angst um seine Tochter gehabt und hat die Situation vielleicht falsch verstanden. Aber er hat sein Unrecht eingesehen und lässt dich gehen.“
„Die Tochter ist mutig. Chágha tho hat sie nur vorm Tod gerettet, aber er versteht die Angst des Vaters und akzeptiert seine Entschuldigung.“ Damit sprang der Indianer auf und Malcolm war über die Schnelligkeit überrascht, mit der er es getan hatte. Hätte er jetzt einen Angriff gegen ihn geführt gehabt, wäre er hoffnungslos verloren gewesen. Doch der Indianer griff an Malcolm vorbei und nahm seine Sachen auf, ging zu seinem Pferd und band es los. Ohne ein weiteres Wort oder ohne sich noch einmal umzudrehen, führte er sein Pferd aus dem Stall, sprang auf dessen Rücken, stieß einen markerschütternden Schrei aus und galoppierte davon.
Isabella, die diese Szene aus der Ferne vom Haus aus beobachtet hatte, bekam eine Gänsehaut bei dem Schrei. Sofort dachte sie wieder an die Minuten, als sie ihn zum ersten Mal gesehen hatte. Wie er mit wehenden Haaren und einem stolzen Gesicht neben ihrem Pferd aufgetaucht war und sie panische Angst vor ihm gehabt hatte.
Er war bestimmt ein gefährlicher Mann, den man nicht unterschätzen, durfte aber sie hatte auch eine Seite an ihm kennen gelernt, die zärtlich und einfühlsam war. Doch nun war er fort und sie würde ihn nicht wieder sehen und diese Gewissheit hinterließ bei ihr merkwürdiger Weise ein trauriges Gefühl.
Vier Tage später war auf der Ranch längst wieder der Alltag eingekehrt.
Die Cowboys waren ihrer Arbeit nachgegangen und hatten angefangen, die Rinder auf der Prärie zusammenzutreiben. Nach dem strengen Winter war es wichtig einen Überblick zu bekommen, wie viele Tiere nicht überlebt hatten. Außerdem wollte man die trächtigen Muttertiere und die Kühe mit schon jungen Kälbern von der restlichen Herde trennen, damit die Kälber dicht bei ihren Müttern aufwuchsen und man in ein paar Wochen ihnen leichter ihr Brandzeichen geben konnte.
Danach würde man die Herden wieder zusammenführen. William, als altes Oberhaupt der Ranch, war zwar nicht mehr in die regelmäßige Arbeit mit einbezogen, dennoch war er nach wie vor oft bei den Cowboys und half ihnen. Solange er noch mit seinen alten Knochen ein Pferd besteigen konnte, würde er draußen mithelfen. Auch wenn er etwas kürzer getreten war in der letzten Zeit, so war und blieb die Ranch sein Leben.
Er war immer ein Naturbursche gewesen, der lieber an der frischen Luft war und tatkräftig Hand anlegte, als im Büro den Schreibkrams zu erledigen. Dies war nun die Aufgabe des neuen Bosses und James war darin auch talentierter als er es je gewesen war. Er war stolz auf seinen Sohn, der die Ranch weiter vorwärts brachte.
Isabella hatte in den letzten vier Tagen ihren Schülern wieder Unterricht gegeben. Ihr kleines hölzernes Schulhaus, welches alle zwei Wochen auch als Kirche dem Reverend diente, stand nur ein paar Meter vom Haupthaus entfernt. Es bestand aus einem einzigen Raum, an dessen rechter und linker Seite Bänke standen, in denen am Schultag ihre Schüler saßen und an den Kirch Sonntagen die Farmbewohner.
An der hinteren Wand befand sich eine Tafel, vor der ihr Schreibtisch stand. In der einen Ecke stand ein Schrank, in dem sich Bücher und anderes Schulmaterial befand. Ihr Klavier, worauf sie bei den Gottesdiensten spielte, befand sich gleich daneben. Der Raum hatte rechts und links jeweils zwei Fenster, durch die die Frühlingssonne jetzt schon recht kräftig schien. Gerade als der Unterricht beendet worden war und die Schüler nachhause gingen, verließ auch sie kurz darauf das Schulgebäude und ging zum Haupthaus hinüber. Die Wunden an ihrem Oberschenkel waren schon recht gut verheilt, sodass sie beim Laufen keine Schwierigkeiten mehr hatte.
Mit einem Mal ritt Dan, einer der Cowboys, im wilden Galopp an ihr vorbei zum Haupthaus hinüber. Dort angekommen brüllte er: „Boss, Boss der Indianer ist wieder da.“
Er wollte gerade die Stufen hinauf stürmen, als von drinnen die Türe aufgerissen wurde und ihr Vater auf der Veranda erschien. Beim Näherkommen hörte sie ihn fragen: „Was hast du da gerade gesagt?“
„Der Indianer ist wieder da. Wir haben ihn oben auf dem Hügel vorm Wald sitzen sehen. Er hat sogar ein Lagerfeuer angemacht.“
„Seit wann ist er da und was macht er?“
Читать дальше