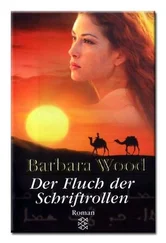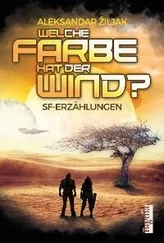„Ich weiß nicht genau, wie lange er schon da ist, wir haben ihn gerade gesehen, als wir eben in der Nähe auf der Weide gearbeitet haben. Er sitzt nur da und scheint uns zu beobachten. Macht sich auch nicht die Mühe im Verborgenen zu bleiben. Ich dachte nur, ich sag gleich Bescheid.“
„Das hast du schon richtig gemacht. Reit los und such mir Malcolm. Er soll sofort hierherkommen. Ich will wissen, was da vor sich geht. Die ganze Sache schmeckt mir nicht.“
„Ist gut Boss, bin schon weg.“
Damit bestieg er wieder sein Pferd und machte sich auf die Suche nach Malcolm.
Isabella hatte alles mit angehört, nun eilte sie hinter ihrem Vater her, der gerade wieder ins Haus gehen wollte.
„Was hast du jetzt vor?“
„Ich werde mit Malcolm hinreiten und ihn fragen, was er will. Ich will nicht, dass er hier bei uns herumschleicht.“
„Wirst du ihn wieder gefangen nehmen, oder ihm was tun?“
„Ich hoffe, dass es dazu nicht kommen wird, aber sollte es Probleme geben, werde ich nicht zögern, etwas zu unternehmen.
Nachdem er die Ranch vor vier Tagen verlassen hatte, war er weiter südlich geritten. Er hatte sich weiter auf die Suche begeben wollen. Doch am darauf folgenden Tage hatte er in der Ferne eine Ansiedlung gesehen. Neugierig war er auf eine Anhöhe geritten und hatte von dort oben einen prächtigen Ausblick auf die unter ihm liegende Prärie gehabt. Allerdings hatte er auch die Unterkünfte der Weißen gesehen.
So viele Häuser und auch Menschen, die in den Gassen unterwegs waren, hatte er noch nie gesehen. Sein Stamm war schon groß gewesen, aber gegenüber dieser Anzahl von Weißen waren sie nur in der Minderheit. Am Rande des Ortes sah er außerdem das Fort der Armee liegen. Groß und gut bewacht stand es da. Von seiner Position aus konnte er klar die acht Wachtürme ausmachen und sehen, welche Tätigkeiten die Soldaten im Fort ausübten.
Sein Vater, der Häuptling, hatte ihm und den jungen Kriegern seines Stammes immer wieder von den Kämpfen der Soldaten mit den Indianern erzählt. Er hatte geglaubt, eines Tages würde der weiße Mann wieder verschwunden sein, doch als Chágha tho dieses Fort und die vielen Menschen in der Stadt nun sah, war er sich nicht mehr sicher, ob der alte Häuptling Recht behalten würde. Nachdenklich geworden, hatte er das Treiben unten im Tal noch einen ganzen Tag lang beobachtet und
am nächsten Tag gesehen, wie ein Treck mit vielen Wagen jubelnd von den Soldaten im Fort und in der Stadt begrüßt worden war. Irgendetwas löste sich in ihm aus, als er dieser Szene beobachtete.
Er konnte nur nicht genau sagen, was es war. Alle schienen einen glücklichen Eindruck zu machen. Seit Chágha tho seinen Stamm verlassen hatte und die vielen Tage und Nächte alleine unterwegs gewesen war, war er sehr nachdenklich geworden. In letzter Zeit erwischte er sich immer mehr dabei, dass er über die Zukunft nachdachte und was sie ihm bringen würde. Er hatte oft zu Manitou gebetet und versucht zu ergründen, was er mit ihm vorhatte.
Seiner Meinung nach lag das Problem zwischen Weiß und Rot dabei, dass ein jeder den Anderen nicht verstand. Wenn er die Sprache der Weißen sprechen würde und er war sich sicher, dass er sie lernen könnte, dann könnte er ihnen viele Dinge erklären und umgekehrt. Chágha tho sah gedankenverloren in die Ferne, er verstand sich im Moment selber nicht mehr. Früher, da waren ihm solche Gedanken fremd gewesen.
Da hatte es gereicht, dass er der Sohn des Häuptlings war und seinen Platz innerhalb des Stammes hatte. Doch es war längst nichts mehr so wie früher. Der alte Häuptling war tot und er hatte den Stamm verlassen und würde wahrscheinlich nie wieder zurückkehren. Nun allein auf sich gestellt schien es ihm wichtig zu sein, alles über die Weißen zu lernen. Doch er war weder dumm noch leichtsinnig. Er wusste, wenn er da hinunterreiten würde, wäre er ein toter Mann oder aber zumindest ein Gefangener der Armee.
Wenn er tatsächlich etwas über die Weißen lernen wollte, musste er es schlauer anfangen. Und so hatte er vor zwei Tagen den Entschluss gefasst, zurück zu der Ranch zu reiten. Zwar waren sie ihm da auch nicht gerade mit offenen Armen entgegen gekommen, dennoch zog ihn etwas dahin zurück. Vielleicht konnte er einen Deal mit dem Vater der Tochter machen. Ein Versuch war’s wert, fand er und so hatte er sich auf den Weg zurückgemacht.
Nun saß er wieder an der Stelle, an der er vor vier Tagen von den Cowboys eingekreist und gefangen genommen worden war.
Er wollte nicht im Verborgenen bleiben und es ihnen leicht machen, ihn zu sehen. Mit dem Lagerfeuer, welches er entzündet hatte, würde es nicht lange dauern, bis sie seine Anwesenheit bemerken würden und von da an würde es sich zeigen, ob Manitou ihn beschützte oder ob er hier den Tod finden würde. Die Cowboys waren mit dem Vieh beschäftigt. Er konnte sehen, wie sie die Tiere zwischen den Büschen und Tannen in dem unüberschaubaren, weiten Gelände aufstoben und zusammentrieben.
Warum sie das machten, verstand er nicht aber er verfolgte das Tun mit großem Interesse. Es dauerte länger als er gedacht hatte, bis er sehen konnte, wie die Cowboys bei ihrer Arbeit innehielten und in seine Richtung schauten. Kurz danach galoppierte einer von Ihnen zum Haupthaus hinüber. Nun würde es nicht mehr lange dauern. Chágha tho nahm die Zügel seines Pferdes und hielt sie in der Hand. Seine Waffen lagen griffbereit neben ihm. So, am Lagerfeuer sitzend, erwartete er die Ankunft des Ranchbesitzers. Denn da war er sich sicher, dieses Mal würde er persönlich kommen.
„Da oben ist er, Boss. Der Junge ist entweder mächtig dumm oder hat Mut. Nach allem, was passiert ist, kommt er wieder und setzt sich erneut der Gefahr aus.“
„Wenn ich nur wüsste, was er im Schilde führt.“
„Das werden wir gleich erfahren.“
Malcolm und James trieben ihre Pferde den Berg hinauf und kamen dann seitlich aus dem Wald auf den Indianer zu. Dieser saß friedlich am Lagerfeuer, und als die beiden Männer erschienen, machte er eine einladende Geste, damit sie sich zu ihm ans Feuer gesellten.
James sah etwas verwundert zu Malcolm hinüber, der bereits vom Pferd stieg.
„Boss steigen sie ab und kommen sie zum Lagerfeuer. Das Gewehr nehmen sie mit, legen sie es sich aber über die Arme, damit es keine bedrohliche Geste ist.“
Er sah, wie Malcolm das Gleiche tat, und schritt dann zum Feuer hinüber, wo Malcolm sich setzte und das Gewehr neben sich ins Gras legte. James ließ sich ebenfalls nieder und schaute dem Indianer dabei forsch in die Augen. Einschüchtern lassen wollte er sich nicht von diesem jungen Burschen. Die Blessuren, die er ihm vor Tagen zugefügt hatte, waren inzwischen fast verblasst und so sah er zum ersten Mal, dass der junge Mann markante Gesichtszüge hatte. Seine hohen Wangenknochen und die gerade Nase verliehen ihm fast ein aristokratisches Aussehen. Das lange Haar, welches in zwei Zöpfe geflochten war, war schwarz wie Kohle. Seine Haut war nur etwas dunkler als seine eigene. Das aber wohl auffallendste Merkmal an ihm waren seine himmelblauen Augen. Solche Augenfarbe hatte er erst einmal in seinem Leben gesehen und das war schon lange her. Nun merkte er, wie dieses Augenpaar ihn genau beobachtete. Sie hatten eine Weile schweigend sich gegenübergesessen. Ein jeder versuchte, den anderen einzuschätzen, doch nun eröffnete Malcolm das Wort an den Indianer.
„Was machst du hier?“
„Ich beobachte euch und lerne.“
Etwas verdutzt über die Antwort, sah er erst James an, der ihn fragend anschaute und dann wieder den Indianer.
„Was ist Malcolm, was hat er gesagt?“
„Gleich, ich muss das noch einmal hinterfragen. Du bist hier und beobachtest uns? Warum? Das verstehe ich nicht.“
„Ich habe die vielen Menschen gesehen und das Fort der Armee. Chágha tho möchte die Weißen verstehen. Ihre Sprache lernen und sehen wie sie leben. Deshalb bin ich zurückgekommen.“
Читать дальше