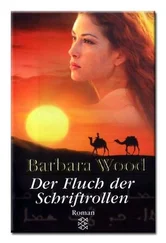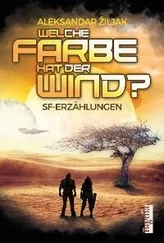Er diente nicht nur den Bewohnern, sondern auch dem Vieh als Wasserquelle. Malcolm erzählte, dass dieser Fluss nie austrocknete, selbst in den trockensten Sommermonaten führte er genug Wasser, um Mensch wie Tier am Leben zu erhalten. Das war ein Gottes Geschenk in dieser Gegend. Im Winter fror er selten zu, da er genug Strömung hatte und jetzt im Frühjahr, nach den Schneeschmelzen, war es oft nicht so einfach ihn zu überqueren, da er dann viel Wasser führte und die Strömung zu nahm. Er zeigte Chágha tho eine der Stellen, an denen es eine kleine Furt gab und man den Fluss gut überqueren konnte.
Am anderen Ufer stiegen sie ab und machten Rast. Malcolm entnahm seiner Satteltasche etwas zu essen, welches ihm Isabella heute Morgen gegeben hatte, und reichte Chágha tho seine Hälfte. Dieser starrte auf das Brot in seinen Händen und war sich nicht ganz sicher, ob er es essen sollte oder nicht. Doch als Malcolm sich ins Gras setzte und beherzt in seine Hälfte biss und ihm zunickte, tat er das Gleiche und fing an erst an dem Brot zu knabbern und dann mit immer mehr Appetit das Brot zu verschlingen. Malcolm hatte ihn still beobachtet. Jetzt musste er schmunzeln und meinte: „Gut, nicht wahr?“
Mit vollem Mund nickte Chágha tho und aß weiter.
„Ja Isabella ist eine gute Köchin. Der Mann, der sie mal abbekommt, wird es gut haben.“
„Mmh“
Das Essen war fremd für ihn, aber es schmeckte und irgendwie kam es ihm vor, als wenn er in seinem Leben schon einmal Brot gegessen hatte. Doch wann das gewesen sein sollte, konnte er nicht sagen.
Chágha tho erhob sich, nahm seine Wasserflasche und ging zum Fluss hinüber um sie zu füllen. Als er wieder zurückkam, wandte er sich mit einer Frage an Malcolm, die ihn brennend interessierte.
„Hat Isabella einen Mann, der sie beschützt?“
Etwas erstaunt über diese Frage antwortete Malcolm.
„Nein, sie ist nicht verheiratet. Ihr Vater beschützt sie und irgendwann wird sie bestimmt auch einen Rancher heiraten.“
„Warum hat ihr Vater noch keinen Mann für sie ausgesucht? Ist der Preis zu hoch?“
Malcolm, der einen großen Schluck von seinem Wasser genommen hatte, verschluckte sich bei der Frage. Er musste kräftig Husten. Was hatte der Junge bloß für Ansichten. Doch dann fiel es ihm wieder ein, dass er gehört hatte, dass Indianer das Thema Beziehung und Liebe etwas pragmatischer sahen als es die Christen taten. In Gedanken suchte er nach der richtigen Antwort.
„Was will er haben? Pferde oder Felle? Sie muss einen hohen Preis haben, wenn sie immer noch bei ihrem Vater ist.“ Chágha tho machte ein nachdenkliches Gesicht und rieb mit der Hand sein Kinn. Malcolm hingegen, der seinen Hustenreiz überwunden hatte, versuchte nun ihm zu erklären, das man bei ihnen keine Frauen kaufte oder durch Ware tauschte.
„Bei uns darf die Frau selber ihren Mann auswählen. Frauen und Männer heiraten aus Liebe. Sie geben sich zusammen ein Versprechen, das sie ihr Leben lang zusammenbleiben wollen, bis der Tod sie trennt. Gründen dann eine neue Familie und leben in einem eigenen Haus. Vor dem Versprechen kann der Mann beim Vater der Frau um Erlaubnis fragen.“
Chágha tho nahm wieder neben Malcolm im Gras Platz und dachte darüber nach, was er gerade gehört hatte.
„Was ist Liebe?“
„Junge, du stellst Fragen. Ich weiß, nicht ob ich da der Richtige bin, der dir das beantworten kann.“
Malcolm rieb sich mit etwas Unbehagen den Nacken. Er blickte in die erwartungsvollen blauen Augen des jungen Mannes und suchte nach den passenden Worten.
„Nun - Liebe das ist ein Gefühl. Das hat man, wenn man jemanden mag. Richtig gern mag.“
Die Miene des Jungen hellte sich auf. „Dann liebt Chágha tho, Malcolm.“
Freudig strahlte und nickte der Junge ihn an, weil er glaubte, verstanden zu haben und Malcolm wusste, er musste ihm das mit der Liebe gleich noch einmal etwas besser erklären. Was würden die Anderen denken, wenn sie mitbekommen würden, dass Chágha tho von Liebe redete, wenn er eher das Wort „nett“ meinte.
„Das ist so nicht ganz richtig. Liebe ist ein Gefühl zwischen einer Frau und einem Mann. Wenn du das zu einem Mann sagst, wirst du dir Ärger einfangen. Du kannst zu mir sagen, dass ich „nett“ oder „ok“ bin. Ich denke, das ist das, was du gemeint hast. So, nun müssen wir aber weiter. Wir haben noch etliches zu schaffen, bevor wir wieder nachhause können.“
Malcolm raffte sich auf, erleichtert darüber, sich nun wieder der Arbeit widmen zu können und verstaute seine Wasserflasche am Sattel. Chágha tho tat es ihm gleich und wenig später setzten sie beide ihren Weg fort.
Die Ranch musste riesig sein. Sie waren nun schon seit Stunden unterwegs und außer Rindern, die friedlich zwischen Büschen und Zedern sich bewegten, sah man nichts. Die Gebäude und die Stallungen waren schon lange nicht mehr zu sehen und auch keine Zäune mehr. Die schneebedeckten Berggipfel, von den großen Bergen, konnte man in der Ferne sehen. Sie ragten hoch in den blauen Himmel empor, während sie in einem Gelände mit kleinen Senken und Hügeln unterwegs waren. Saftiges Grün vermischt mit Prärieblumen, Sträuchern und kleinen Büschen erstreckte sich um sie herum, soweit das Auge reichte. Vereinzelt sahen sie kleine Herden von schwarzen Angus Rindern, die sich schattige Plätze gesucht hatten.
„Sind wir immer noch auf Ranchgebiet“, wollte Chágha tho wissen.
„Ja, wir haben heute nur einen kleinen Teil davon gesehen. Nach dorthin,“ Malcolm zeigte mit dem Arm in östliche Richtung, sind es zwei Tagesritte, bevor wir die Grenze erreichen. Dann noch einen Tagesritt weiter, bevor die nächste Ranch kommt. Nach Norden erstreckt sich noch einmal ein Gebiet, von der Größe was wir heute gesehen haben und wenn du vom Haupthaus dich südlich hältst, dann brauchst du ebenfalls ein paar Stunden, bevor du den Grenzzaun erreichst.“
„Warum braucht der weiße Mann soviel Land?“
„Er hat viele Rinder und die brauchen Platz, damit sie sich gut entwickeln und gutes Fleisch produzieren. Der Boss versorgt damit die Leute in der Stadt und auch die Soldaten.“
„Warum? Gehen die Leute nicht mehr selber auf die Jagd?“
„Nun ein paar schon, aber nicht alle. Du hast doch die Stadt gesehen. Es sind viele Menschen dort und sie bauen Häuser und Geschäfte, in denen sie ihre Waren verkaufen. Diese Leute haben keine Zeit, sich selber auf die Jagd zu begeben. Auch die Soldaten können es nicht, weil ihre Aufgabe ist, uns zu beschützen. Deshalb hat der Boss hier diese Rinder, die er gegen Geld an die Menschen verkauft und dann mit dem Geld wieder Essen für uns besorgt. So funktioniert das bei uns.“ Achselzuckend ritt er weiter, der Indianer schweigsam hinter ihm her. Chágha tho hatte heute viel gelernt. Auch wenn er nicht alles verstand, was der weiße Mann so tat, hatte er doch das Gefühl, das es eine gute Idee gewesen war, hierher zu kommen.
Die Sonne war schon hinter den Berggipfeln untergegangen und nur noch wenig Licht drang zu den Gebäuden vor ihnen durch, deren Umrisse sie nun in der Ferne sehen konnten. Gleich würde es dunkel sein und mit der Dunkelheit würde auch die Wärme gehen, die sie heute den ganzen Tag schon zu spüren bekommen hatten.
Malcolms Brauner Wallach, der wusste, dass es nachhause ging, verschärfte das Tempo ein wenig und der schwarze Rappe neben ihm, fing freudig an zu wiehern, als er merkte, dass sein Besitzer ihn nicht zurückhielt. Die beiden Pferde legten einen scharfen Galopp hin und Malcolm wunderte sich, dass sein Pferd nach diesem Tag noch die Energie dazu hatte. Scheinbar waren Hafer und frisches Stroh, Motivation genug.
Als sie vor dem Stall mit dem dahinter liegenden großen Paddock ankamen, waren die anderen Cowboys schon lange mit der Versorgung ihrer Pferde fertig. Das Paddock war voll und man sah alle Pferde fressen und trinken. Auch die Männer waren nicht mehr zu sehen, bis auf zwei, die noch Eimer mit Hafer zu den Tieren schleppten.
Читать дальше