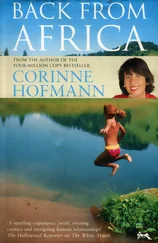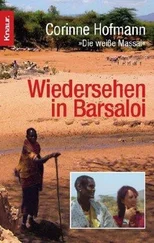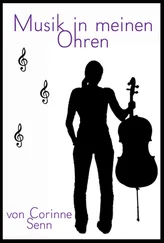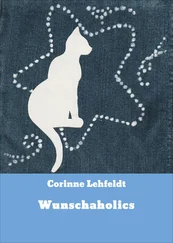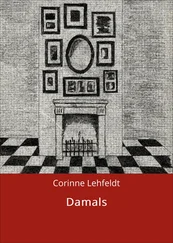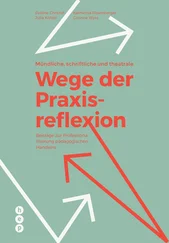CMF: Haben die Technokratien Asiens einen Vorteil in der Bewältigung dieser wirtschaftlichen Folgen?
MS: Sie haben zumindest den Vorteil, dass sie viel massivere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie durchführen können. Das haben wir in China gesehen. Dort wurde sehr früh, sehr radikal abgeriegelt. Die Chinesen haben die Menschen in ihren Wohnungen mehr oder weniger eingesperrt, und man konnte nur nach Tests, nach Fiebermessen, das Haus verlassen. Ob das bei uns auch so möglich wäre, das wage ich sehr zu bezweifeln. Die Hoffnung ist, dass es andere Möglichkeiten gibt, um das weniger invasiv, aber trotzdem effektiv, zu handhaben.
CMF: Weniger invasiv verlangt natürlich auch mehr Einsicht der Bürger.
MS: Da habe ich bei manchen von unseren Bürgerinnen und Bürgern ein bisschen Sorge, aber ich hoffe, dass die Menschen sich jetzt vernünftig verhalten.
CMF: Kann man aus der bereits beginnenden Erholung Chinas Rückschlüsse ziehen, wie sich eine wirtschaftliche Erholung in Europa gestalten wird?
MS: Das ist nicht ganz einfach einzuschätzen, gerade weil China aktuell damit konfrontiert ist, dass die Handelspartner Europa und USA ausfallen. Man kann hoffen, dass bei uns die Erholung rascher funktioniert, denn wenn bei uns und in den USA die Pandemie voll zuschlägt, wird sich China schon wieder auf dem Weg der Erholung befinden. Daher bin ich sogar optimistisch, dass es bei uns besser laufen wird. Es sei denn, es kommt in China zu einer zweiten Welle. Ob es weitere solcher Wellen geben wird und wie stark diese ausgeprägt sein werden, das hängt ganz davon ab, wie konsequent die Maßnahmen jetzt weiterverfolgt werden.
CMF: Zu Ihren wissenschaftlichen Schwerpunkten zählen auch Wettbewerbsfragen. Insolvenzen von Unternehmen scheinen unvermeidlich. Ein Ausweg sind hier oft nur Übernahmen durch Wettbewerber, diese sind aber durch das Kartell- und Fusionsrecht stark reguliert. Müssen wir hier jetzt flexibler sein, um Arbeitsplätze zu retten?
MS: Wir müssen alles dafür tun, Arbeitsplätze zu retten. Die Frage ist immer, was das richtige Instrument ist. Wenn man jetzt Kartellrechtsfragen mit dem Argument, dass eine Fusion Unternehmen rettet, einfach so beiseiteschiebt, hätte ich Sorge, dass uns das irgendwann auf die Füße fallen würde. Wenn die Krise vorbei ist und wir dann stark konzentrierte Märkte haben, wird das möglicherweise auch den Aufschwung behindern. Insofern sollte man darauf achten, welche Investoren bereit sind, Unternehmen zu übernehmen. Wenn es Auswahl gibt, sollte man auf die Investoren setzen, die nicht unmittelbare Konkurrenten sind, sondern beispielsweise in ganz anderen Märkten arbeiten. Man sollte, wenn nötig, Auflagen machen. Das ist ein gängiges Verfahren bei Fusionen, wenn die Gefahr besteht, dass die Konzentration zu stark steigt: Die Genehmigung der Fusion wird davon abhängig gemacht, dass bestimmte Teile abgespalten werden müssen, damit die Konzentration nicht zu stark wird. Besser wäre es möglicherweise, dass man Insolvenzen vermeidet, indem man entsprechende Bürgschaften und Garantien gibt. Möglicherweise auch, indem der Staat sich für eine gewisse Zeit durch Eigenkapitalbeteiligungen einbringt. Nur muss es an dieser Stelle klare Exit-Strategien geben, denn eine solche Beteiligung darf nicht dauerhaft sein. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer.
CMF: Bei der Commerzbank ist der Staat seit der Finanzkrise dabei, obwohl er sich auch zurückziehen wollte.
MS: Das ist ein abschreckendes Beispiel. Man sollte erst klären, wie man es schaffen kann, dass genau das nicht passiert. Insofern sind auch viele Experten skeptisch und setzen lieber auf Kredite. Wenn es aber darum geht, Konzentrationstendenzen zu vermeiden, ist das eine Abwägung von verschiedenen Übeln, um das angestrebte Ziel zu erreichen, Unternehmen, die eigentlich überlebensfähig sind, nicht insolvent gehen zu lassen. An dieser Stelle will ich aber auch sagen: Unternehmen, die schon vor der Krise in Schwierigkeiten waren, sollten nicht unterstützt werden. Wichtiger ist es, dass nach der Krise neue Unternehmen entstehen.
CMF: Innerhalb der EU fordern viele Staaten die Einführung sogenannter Corona-Bonds. Deutschland lehnt diese ab, wie auch die Eurobonds in der Euro-Krise. Was denken Sie?
MS: Länder wie Italien oder Spanien sind im Moment durch die Krise besonders hart getroffen. Sie haben einen sehr hohen Schuldenstand im Vergleich zu uns. Das erschwert ihnen besonders, die Mehrausgaben, die sie jetzt haben, durch weitere Kredite zu finanzieren. Deswegen ist es ganz zentral, dass wir eine Lösung finden, wie man diesen Staaten helfen kann, ohne dass sie sich zu stark überschulden und dadurch in die nächste Eurokrise schlittern bzw. für uns alle die nächste Eurokrise vorprogrammieren. Darüber besteht Einigkeit. Der Dissens besteht in meinen Augen vor allem darin, was die richtigen Instrumente sind.
In diesem Zusammenhang werden jetzt Corona-Bonds diskutiert. Die Idee ist, die europäischen Staaten geben Corona-Bonds aus, verschulden sich damit gemeinsam und haften dann auch gemeinschaftlich für die Zinsen und Rückzahlung. Das hätte für Länder wie Italien oder Spanien den Vorteil, Kredite zu günstigeren Zinsen zu bekommen und sich so auch weniger zu verschulden. Die Schuldenlast insgesamt würde geringer sein, weil starke Länder wie Deutschland mithaften würden. Das ist in vielerlei Hinsicht attraktiv, hat aus meiner Sicht aber den Nachteil des Zeitfaktors. Es dauert lange, dieses Instrument auf den Weg zu bringen. Man hat hohe institutionelle und rechtliche Hürden. Beispielsweise muss alles durch die Parlamente gehen – ganz abgesehen davon, dass man sich europäisch erst einmal einigen muss.
Aus meiner Sicht spricht allein vom Zeitfaktor her schon einiges dafür, dass man auf bestehende Instrumente wie den europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) setzt. Den hat man in der Finanzkrise entwickelt, damals für die Banken. Man müsste den ESM natürlich auf die konkrete Situation hin anpassen. Einige Staaten lehnen das aber ab, insbesondere Italien. Warum? Sie fürchten, dass dieses Instrument stigmatisierend wirken könnte. Bisher wurde das immer nur dann verwendet, wenn ein Land in Schwierigkeiten geraten ist, und es ist mit Auflagen verbunden. Schon im Falle Griechenlands kam es gar nicht gut an, wenn die Troika kam und sagte: „Das und das müsst ihr jetzt machen.“ Deshalb muss man sich überlegen, wie man die Stigmatisierung vermeiden kann und welche Auflagen wirklich nötig und möglich sind. Vielleicht müssen wir uns alle an die gleichen Auflagen halten, sodass sie nicht nur ein Land stigmatisieren, oder aber man überlegt sich ganz andere Lösungen. Die EU-Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen hatte vorgeschlagen, dass man die Zahlung des Kurzarbeitergeldes durch die EU finanzieren könnte und dafür gemeinsame Kredite aufnimmt. Das hätte einen ähnlichen Effekt wie die Corona-Bonds. Ich kann nicht einschätzen, ob es dazu politische Einigkeit geben wird.
Schließlich sollte man an Lösungen denken, mit denen direkte Zahlungen an die betroffenen Länder geleistet werden können. Beispielsweise wird diskutiert, Zahlungen an den EU-Haushalt für die Länder auszusetzen, die jetzt besonders schlimm betroffen sind. In diesem Fall müssten deren Ausfälle durch andere Staaten, die es sich besser leisten können, kompensiert werden. Auch das wäre eine Möglichkeit. Aus meiner Sicht ist es entscheidend, dass wir rasch eine europäische Lösung finden. Das ist nicht nur ein Gebot der Solidarität, es ist am Ende auch in unserem eigenen Interesse. Wir sind in Europa wirtschaftlich so stark miteinander verbunden, dass wir alle betroffen sind, wenn ein Land durch die Krise in die finanzielle Schieflage gerät.
CMF: Wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist Ihre größte Befürchtung? Was ist Ihre größte Hoffnung?
Читать дальше