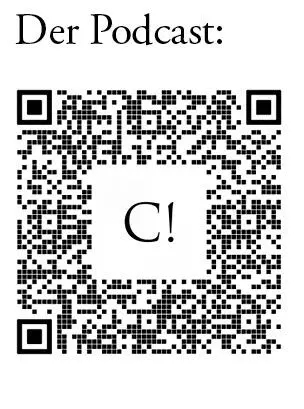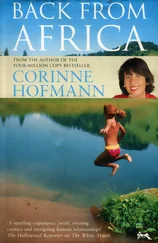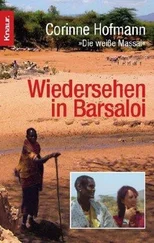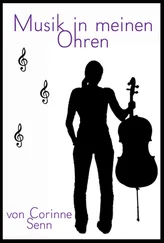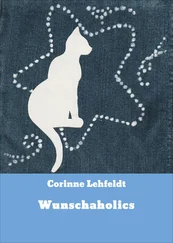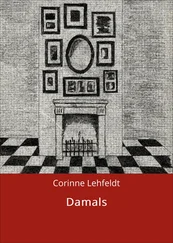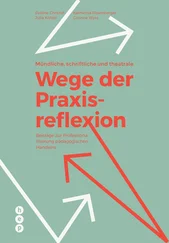CMF: Timo Meynhardt, dessen Lehrstuhl du ja großzügigerweise an der Handelshochschule Leipzig unterstützt, hat gesagt: „Wer beiträgt, führt, wer nicht beiträgt, kann nicht führen.“
AO: Ja, das stimmt. Das unterstreiche ich auch.
CMF: Du trägst seit vielen Jahren wesentlich zur deutschen Wirtschaft bei.
AO: Hat mir Roland Berger auch gesagt, als ich an meinem 80. Geburtstag mit ihm telefoniert habe. Das fand ich sehr nett von ihm. Ich bemühe mich. Solange ich lebe, tue ich das.
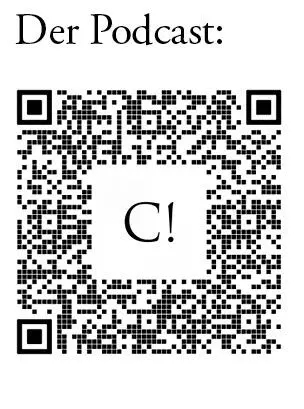
Zu diesem Thema:
Gespräch 5: Monika Schnitzer
Gespräch 9: Gisbert Rühl
7.
Eigenverantwortung im Sinne von Solidarität und Freiheitsrechten
Corinne M. Flick im Gespräch mit Ingolf Pernice, Professor für Öffentliches Recht sowie Gründer und Direktor i.R. des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft, am 28. April 2020
Corinne Michaela Flick: Im Kampf gegen das Corona-Virus setzen viele asiatische Staaten Technologien zur Überwachung ein. In westlichen Demokratien gibt es ebenfalls den Wunsch, die Bewegungsdaten der Bürgerinnen und Bürger zu analysieren. Die Krise scheint die Nutzung neuer Technologien im besonderen Maße zu beschleunigen. Genehmigungsverfahren werden abgekürzt. Sehen Sie darin eine beunruhigende Entwicklung?
Ingolf Pernice: Nein, im Prinzip nicht. Es ist gut, dass Genehmigungsverfahren schneller abgeschlossen werden. Technologien müssen gerade bei solchen Krisen wie im Moment schnell entwickelt werden. Allerdings sollte die Sorge um Datenschutz und andere Dinge, die durch einen Missbrauch damit verbunden sein könnten, nicht zu leichtgenommen werden. Das heißt, die Genehmigungsverfahren sind wichtig, aber sie sollten nicht zu lange dauern. Am Ende ist das eine Frage der Abwägung.
CMF: Ein wichtiger Aspekt der Debatte über digitales Tracking ist die Frage, ob es auf freiwilliger Basis erfolgt oder für alle Bürger verpflichtend ist. Die europäischen Länder tendieren dazu, es als freiwillige Option anzubieten. Was ist hier Ihre Meinung?
IP: Ich bin an sich dafür, Freiwilligkeit mit Solidarität und Selbstverantwortung zu verbinden. Ich würde es immer unterstützen, die Menschen darum zu bitten, solche Tracking-Software freiwillig runterzuladen und zu nutzen, um der Rückverfolgung des Corona-Virus besser dienen zu können. Ich habe gewisse Zweifel, ob Freiwilligkeit in einem solchen Fall genügt. Man sollte es aber zunächst einmal versuchen und erst im zweiten Schritt daran denken, dass auch eine obligatorische Einführung nicht außerhalb der Möglichkeiten steht.
CMF: Es gibt auch die Möglichkeit, dass Informationen nicht zentral von Regierungen gesammelt werden, sondern dass die Bürger über ein Peer-to-Peer-System untereinander erfahren, ob sie in Berührung mit dem Virus gekommen sind. Finden Sie so eine Peer-to-Peer-App besser als eine App, die die Information an den Staat weitergibt?
IP: Ich glaube nicht, dass Informationen an staatliche Behörden persönlich identifizierbar sein müssen. Wie Sie bereits sagten, gibt es Möglichkeiten und Technologien, um Informationen anonymisiert weiterzugeben. Es ist also denkbar, dass ich mir eine App herunterlade, die über Bluetooth aufzeichnet, welche Personen mit mir in den letzten Tagen in näherem Kontakt waren und wie lange. In dem Fall, dass bei mir eine Infektion festgestellt wird, kann diese Technologie all diese Personen automatisch und anonym informieren: „Du warst mit jemandem in Kontakt, der positiv getestet wurde. Bitte begib Dich in Quarantäne und beobachte genau, ob Symptome auftreten.“ Der Trick dabei ist, dass weder ich als möglicher Infektant noch die anderen als möglicherweise Infizierte identifiziert werden und trotzdem alle über diese App benachrichtigt werden, dass ein Problem vorliegt. Das würde ich absolut für das ideale Instrument zur Eindämmung der Ansteckung ansehen, und es würde eigentlich niemandem Schaden bringen.
CMF: Jetzt sind wir bei der Verantwortung des Bürgers, der dann auch handeln muss und sich selbst zurückzieht.
IP: Ja. Zudem hat derjenige, der die App runterladen muss, keinen unmittelbaren, eigenen Vorteil daran. Vermieden wird nur, dass die Person, die infiziert wurde, andere ansteckt – wenn sie sich denn isoliert. Diese Verantwortung kann die andere Person haben und ausüben. Darauf muss man pochen: „Sorge dafür, dass andere nicht durch dich gefährdet werden.“ Ob diese Eigenverantwortung jedes Einzelnen im Sinne der Solidarität reicht, das ist die Frage. Wenn nicht, dann brauchen wir ein Gesetz oder eine Verordnung, die das zur Pflicht macht.
CMF: Brauchen wir in dieser Situation Unternehmen wie Google/Alphabet, die länderübergreifende Informationen nachverfolgen und speichern können?
IP: Wenn es darum geht, Trends zu erkennen, wo bestimmte geografische Schwerpunkte in der Verbreitung des Virus sind, können Unternehmen wie Google möglicherweise Informationen bieten, zum Beispiel auf Basis der Anfragen an ihre Suchmaschine. Ich würde dies aber nicht als ausreichend gegenüber offiziellen Informationen zur Verbreitung des Virus, etwa vom Robert Koch-Institut, ansehen. Ich war generell überrascht, dass wir uns zunächst einmal völlig auf die Informationen der Johns-Hopkins-Universität gestützt haben. Die mögen wissenschaftlich hervorragende Methoden haben, aber ich frage mich, woher die Universität die Informationen über Ansteckung und Verbreitung des Virus, zum Beispiel in Deutschland, zuverlässig haben soll, wenn nicht vom Robert Koch-Institut oder anderen Institutionen wie unseren Gesundheitsämtern. Diese sammeln schließlich aufgrund des Infektionsschutzgesetzes und der Meldepflichten der Ärzte sowie der behandelnden Institutionen an erster Stelle solche Informationen. Ich würde also antworten, dass Unternehmen ergänzende Informationen bieten können, vielleicht auch als staatlich unabhängige Kontrollinformationen, aber nicht die Grundlage der Basisinformationen, die offiziell geliefert werden sollten. Ich gründe diese Meinung auf einem Grundvertrauen, dass die von unserem Staat gesammelten und herausgegebenen Informationen auch stimmen.
CMF: Vertrauen in unsere Staaten – das kam auch in anderen Gesprächen heraus. Dennoch hat die Geschichte gezeigt, dass viele Staaten nach einer Krise nicht mehr bereit waren, ihre Ermächtigungen, die sie aufgrund bestimmter Notstände bekommen haben, wieder aufzugeben. Sehen Sie das Risiko, dass jetzt eingeführte Überwachungstechnologien zur Normalität werden?
IP: Mein Vertrauen ist nicht nur in unsere Institutionen und unseren Staat groß, sondern auch in unsere Öffentlichkeit, unsere Medien, in uns selbst als Gesellschaft. Daher würde ich sagen: Nein, diese Gefahr besteht nicht. Sie besteht nicht, wenn wir wachsam bleiben und uns nicht von den schönen Worten derjenigen, die verantwortlich sind, einlullen lassen. Ich denke, dass die Wachsamkeit in Deutschland, ebenso in Österreich, Frankreich und auch Italien, ausreichend groß ist, sodass wir unsere Institutionen notfalls dazu bringen werden, diese Maßnahmen wieder abzuschaffen. Wenn wir eine App haben, in der Daten Peer-to-Peer verschlüsselt sind und in die nicht heimlich irgendwelche Backdoors für den Staat eingebaut wurden, dann bleiben alle Informationen unter uns und das Ganze eine gesellschaftliche Angelegenheit. Wenn wir dazu noch eine automatische Löschung der Kontaktinformationen sicherstellen, beispielsweise dass Daten, die älter als 14 Tage sind, automatisch gelöscht werden, dann habe ich auch keine Befürchtung, dass es in Bezug auf das Thema Überwachungsstaat zu Problemen kommt. Entsprechende Löschungsmechanismen oder Pflichten haben wir ja auch im Datenschutzgesetz. Notfalls wird das durch Whistleblower, aber im Grunde auch durch institutionelle Kontrollen verhindert. Meine Sorge ist jedenfalls in diesem Fall nicht so groß, dass ich jegliche Datensammlung und Überwachung im Rahmen der Corona-Krise ablehnen würde. Damit würden wir den Vorteil dieser Technologien, deren Einsatz wir im Einzelfall entscheiden müssen, außer Acht lassen. Es geht ja nicht nur um die Rettung von Menschenleben, es geht auch um die Bewegungsfreiheitsverbote und um die Schließung von Geschäften, Betrieben und Dienstleistungsunternehmen, von Schulen und Universitäten. Der volkswirtschaftliche Schaden, der damit verursacht wird, kann ebenfalls zu vielen menschlichen Tragödien führen. Wenn wir eine Technologie haben, die es uns erlaubt, diese Verbote zu lockern, weil wir eine gewisse Kontrolle über die Verbreitung des Virus sicherstellen können, dann finde ich, muss man diese Technologie auch nutzen.
Читать дальше