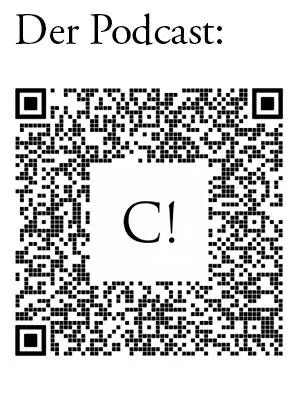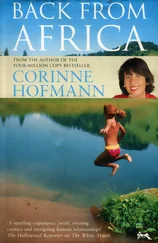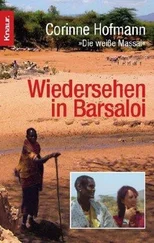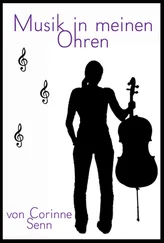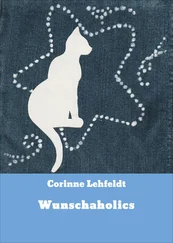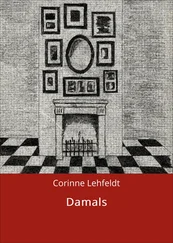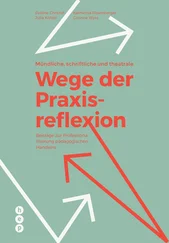CMF: Wie wird sich unsere Gesellschaft durch die gegenwärtige Krise verändern? Was ist Ihre größte Befürchtung, und was ist Ihre größte Hoffnung?
CP: Meine Befürchtung ist, dass all das, was jetzt immer wieder gesagt wird, „wir lernen aus der Krise!“, „Solidarität!“ etc., ungefähr ein, zwei Monate oder ein Jahr nach Ende der Krise wieder verloren sein wird. Das ist nicht einmal eine Befürchtung von mir, sondern das ist Erfahrung. Dass wir aus der Geschichte nichts lernen, ist die größte Befürchtung.
Meine größte Hoffnung ist, dass es diesmal vielleicht klappt, dass wir zumindest jetzt in dieser Phase, in der uns die Fragilität unseres ganzen Lebenskonstrukts bewusst wird, etwas lernen. Wir merken jetzt, auf was für einem schwankenden Untergrund unser tägliches Leben aufgebaut ist. Es bedarf eines winzig kleinen Virus’, das von irgendeinem Teil der Welt kommt, um alles zusammenbrechen zu lassen. Solange wir diese Erfahrung noch in den Knochen haben, hoffe ich, dass wir ein paar Dinge vorantreiben für künftige Krisen, die natürlich kommen werden – vielleicht nicht in Gestalt eines Virus, vielleicht nicht in Gestalt einer Flutwelle, vielleicht nicht in Gestalt einer Derivate-Krise, vielleicht in Form von etwas völlig anderem. Meine Hoffnung ist, dass wir uns bereits jetzt schon hinreichend für diese Krisen wappnen, so dass wir dann nicht so sehr auf dem falschen Fuß erwischt werden, sondern in die Schublade greifen können, um zumindest Lösungsansätze zu haben. Die konkreteste dieser Hoffnungen ist die, dass wir endlich ein Staateninsolvenzrecht in die Wege leiten.
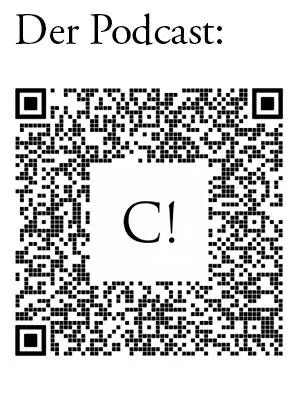
Zu diesem Thema:
Gespräch 19: Heinz Bude
5.
Wirtschaftliche Herausforderungen
in der heutigen Krise
Corinne M. Flick im Gespräch mit Monika Schnitzer, Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München, am 12. April 2020
Corinne Michaela Flick: Die ökonomischen Kosten des Lockdown sind immens. Können wir die Auswirkungen auf die Wirtschaft bereits abschätzen?
Monika Schnitzer: Das ist aktuell noch sehr schwer abzuschätzen. Es hängt vor allen Dingen davon ab, wie erfolgreich die Maßnahmen sein werden, die wir ergriffen haben, um die Infektionsgefahr einzudämmen. Aber es gibt verschiedene Beispielrechnungen. Der Sachverständigenrat hat vor Kurzem ein Sondergutachten veröffentlicht, in dem verschiedene Szenarien diskutiert werden. Die zwei wesentlichen Szenarien sind das sogenannte V-Szenario und das U-Szenario. Was unterscheidet sie? Beim V-Szenario geht man davon aus, dass die Maßnahmen nicht mehr allzu lange beibehalten werden müssen. Dann kommt es zu einer raschen Erholung, einer Normalisierung schon im Sommer. Die Wirtschaftsleistung würde zwar jetzt kurzfristig massiv sinken, dann aber auch wieder schnell steigen. Je nachdem wie lange die Maßnahmen andauern, wird dieses „V“ stärker oder weniger stark ausgeprägt sein. Wenn sich die Maßnahmen hinziehen, dann wären wir bei einem langen U-Szenario. Gerade in diesem Fall besteht dann durchaus die Gefahr, dass Unternehmen in größerem Umfang insolvent werden und es deswegen möglicherweise zu negativen Rückkoppelungen auf die Finanzmärkte und das Bankensystem kommt. Deswegen gilt es, insbesondere diese Insolvenzen zu vermeiden.
CMF: Die staatlichen Hilfsprogramme sind die größten, die es jemals in der Bundesrepublik bzw. in der EU gegeben hat. Erreichen die zahlreichen Hilfsprogramme die betroffenen Unternehmen und Privatpersonen rechtzeitig?
MS: Es war ein großer Kraftakt und gut und richtig, dass die Politik überhaupt so schnell ein derart umfangreiches Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht hat – das größte, das wir je in dieser Form gesehen haben. Die Maßnahmen sind so angelegt, dass sie tatsächlich rasch bei den Betroffenen ankommen. Was ist beschlossen worden? Unter anderem hat man das Kurzarbeitergeld erweitert und verlängert. Das ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Maßnahme, mit der die Unternehmen entlastet und Personalkosten gesenkt werden. Das Kurzarbeitergeld ist ein bewährtes Instrument, das bereits bei der Finanzkrise sehr gut funktioniert hat und das wir in Deutschland den anderen Ländern voraushaben. Denken Sie einmal an England, dort musste ein solches Instrument jetzt auf die Schnelle eingeführt werden. Die USA hat ein solches Instrument überhaupt nicht. Dort werden die Beschäftigten in die Arbeitslosigkeit geschickt. Das hat große Nachteile, weil die Unternehmen die Bindung zu ihren Arbeitskräften verlieren. Nach der Krise müssen erst mühsam neue Arbeitskräfte gewonnen und wieder eingestellt werden. Neben dem Kurzarbeitergeld gibt es jetzt Maßnahmen für Selbstständige und Kleinstunternehmen sowie umfangreiche Kreditinstrumente, um die Liquidität von Unternehmen zu sichern. Es gibt Instrumente wie Steuerstundungen, Garantien, Bürgschaften. Was vielleicht noch fehlt und was man noch stärker ausbauen sollte, sind Hilfestellungen für den Mittelstand, die über Kredite hinausgehen. Warum? Weil Kredite allein zwar Liquidität schaffen, aber nicht die Insolvenzgefahr abwenden und möglicherweise das Risiko mit sich bringen, dass man am Ende überschuldet ist. Deswegen wäre es wichtig zu überlegen, ob man den Mittelstand zum Teil mit direkten Unterstützungsmaßnahmen, beispielsweise durch Steuererlässe, unterstützen kann.
CMF: Wie lange können wir die Wirtschaft in diesem künstlichen Koma am Leben erhalten? Wie kommen wir aus dem Lockdown zurück?
MS: Die entscheidende Frage ist, wie schnell wir die einschränkenden Maßnahmen zurücknehmen können und die Wirtschaft trotz hoher Infektionszahlen schon vorher stufenweise aus diesem Lockdown zurückholen können. Welche Bereiche, in denen die Infektionsgefahr gering ist, können wir öffnen? Welche Bereiche müssen wir länger geschlossen halten?
CMF: Wenn ich Sie richtig verstehe, muss uns jetzt eigentlich allen klar sein, dass es nur stufenweise geht.
MS: Richtig, es muss stufenweise passieren und es muss Unterstützungsmaßnahmen geben. Denken Sie beispielsweise an das Thema Homeoffice. Die Bereiche, die gut im Homeoffice arbeiten können, sollten das auch tun. Dafür brauchen sie aber die notwendige Ausstattung. Ich habe leider von Behörden gehört, die nicht genügend Computer haben, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten zu lassen. Da gilt es, schnell nachzubessern.
CMF: Als Folge der Corona-Pandemie ist eine internationale Rezession, vielleicht sogar eine Depression, zu befürchten. Auch die Emerging Markets sind betroffen. Müssten starke Wirtschaftsnationen, insbesondere die USA, China, Frankreich und Deutschland, eine stärkere Vorreiterrolle einnehmen? Wie sollte diese aussehen?
MS: Alleine durch ihre Wirtschaftskraft werden diese Staaten eine wichtige Rolle dabei spielen, die Weltwirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Sie werden die Impulse setzen. Aber auch hier gilt, dass das erst funktionieren kann, wenn Staaten das Infektionsgeschehen in ihrem Land in den Griff bekommen. Gerade die USA stehen noch ganz am Anfang der Epidemie. Insofern ist es wichtig, dass diese Staaten Impulse liefern, aber wie gut diese Impulse aufgenommen werden, hängt wiederum von der Situation anderer Staaten ab. Wir müssen auf diese Verflechtungen achten und allen helfen, die Krise zu überwinden.
CMF: Dieses Jahr sprechen wir bei Convoco über „New Global Alliances“. Muss es jetzt zu Verbindungen und Kooperationen kommen, die wir bisher gar nicht im Blick haben?
MS: Wir erkennen jetzt noch deutlicher als sonst, wie eng die ganze Welt verflochten ist. Keine Region kann einfach abgeschrieben werden. Wenn das Virus in Entwicklungsländern einschlägt und massive Verwerfungen erzeugt, dann wird uns das am Ende auch betreffen, selbst wenn wir mit manchen dieser Regionen wirtschaftlich kaum verbunden sind.
Читать дальше