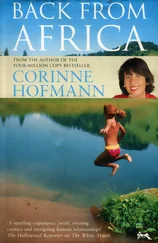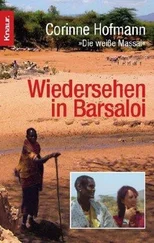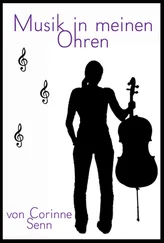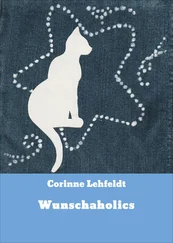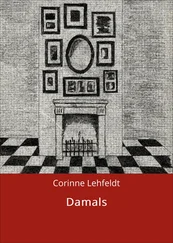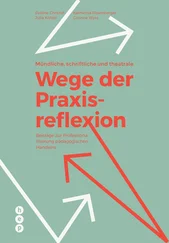CMF: Sie haben jetzt ein wichtiges Wort genannt: „solidarisch“. Die Solidarität ist eines der Kernelemente der EU.
RM: An Solidarität hat es in den letzten Wochen gemangelt. Ich habe nie die Kritik an den Grenzschließungen verstanden, weil ich das eigentlich nur als Fortsetzung der Kontaktbeschränkungen sehe, die wir auf nationaler Ebene haben. Aber das Verbot, Hilfsgüter in die am schwersten betroffenen Staaten zu senden, das hat mich doch sehr irritiert. Wenn Sie sehen, wie die Menschen in Italien sterben, und dann sie damit zu konfrontieren, dass sie weder Atemmasken noch Schutzanzüge bekommen, das tut schon weh, und das tut auch diesen Staaten weh.
CMF: Ein ganz anderes Thema – Sie als Präsident des Bundesfinanzhofs führen jetzt eine sehr wichtige Institution unseres Landes durch diese Krise, was sind dabei die größten Herausforderungen?
RM: Wir sind in einem Spagat. Einerseits müssen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen. Das bedeutet, dass wir alle Maßnahmen ergreifen müssen, um so wenig Kontakt wie möglich zu haben. Auf der anderen Seite sind wir dazu verpflichtet, Rechtsschutz zu gewähren.
CMF: Die Gerichte sind wichtig für unser Land.
RM: Das ist richtig. Die Gerichte müssen auch weiter funktionsfähig bleiben. Dass es natürlich in dieser Umstellungsphase gelegentlich zu Verzögerungen kommen kann, damit müssen wir leben. Die Funktionsfähigkeit der Gerichtsbarkeit aber ist gewährleistet – im Übrigen in allen Ländern und allen Gerichten, mit denen ich in Kontakt bin.
CMF: Wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist Ihre größte Befürchtung, und was ist Ihre größte Hoffnung?
RM: Meine größte Befürchtung ist, dass wir tiefgreifende, strukturelle Schäden im Umgang der Menschen miteinander und in unserer Wirtschaft haben. Ich kann mir eigentlich keine schlimmere Situation vorstellen, als dass zum Beispiel der gesamte Automobilsektor einen dramatischen, langfristig nachhaltigen Schaden erleidet, weil das die Stütze unserer Wirtschaft ist. Wenn diese Bereiche wegbrechen, dann stehen wir vor einer extrem schwierigen Situation. Die größte Hoffnung ist eine große gelebte Solidarität. Ich erlebe in vielen Bereichen, dass die Menschen sich gegenseitig unterstützen. Wenn man dann weiter denkt, muss man anerkennen, wie wichtig die Fortschritte in der Digitalisierung sind. Wir erleben auf diesem Gebiet gewaltige Sprünge, weil die Menschen nun darauf angewiesen sind. Wenn das noch durch ein Digitalministerium begleitet werden würde, das diese Dinge sinnvoll strukturiert, fördert und weiterbringt, dann würden wir auf diesem Gebiet wirklich Fortschritte machen. Wenn das dann noch in einer schönen Steuerreform münden würde, wäre ich glücklich.

Zu diesem Thema:
Gespräch 5: Monika Schnitzer
Gespräch 15: Stefan Korioth
4.
Schlechtwetterzeiten als Herausforderung für die Insolvenz: Solidarität als Grundvoraussetzung
Corinne M. Flick im Gespräch mit Christoph G. Paulus, Professor (a.D.) für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht sowie Römisches Recht der Humboldt-Universität zu Berlin, am 8. April 2020
Corinne Michaela Flick: Herr Paulus, Ihr Thema ist das Insolvenzrecht und das schon seit Jahren. In der gegenwärtigen Krise, die wir durch Corona erleben, tritt dieses Gebiet möglicherweise in den Vordergrund. Was hat Insolvenzrecht mit der gegenwärtigen Krise zu tun?
Christoph G. Paulus: Im Grunde genommen zeichnet sich jede Krise dadurch aus, dass sie früher oder später auf das Ökonomische durchschlägt. Zurzeit sind der Frisör, der die Miete nicht mehr zahlen kann, und der Gaststättenbetreiber, der keine Gäste mehr hat, in aller Munde. Bei ihnen wie aber auch bei allen anderen Unternehmen ist es ein ganz schlichtes Kalkül, dass das finanzielle und wirtschaftliche Überleben mit den vorhandenen Ressourcen endlich ist. Wenn die Ressourcen nicht nachkommen, tritt der Bereinigungs- bzw. der Beendigungsmechanismus des Insolvenzrechts ein. Insofern ist das Insolvenzrecht das drohende Hintergrundrauschen, das immer lauter wird, auch und besonders in der gegenwärtigen Krise.
CMF: Ist denn das Insolvenzrecht auf eine solche Krise vorbereitet? Ist es das richtige Instrument?
CP: Nach meiner Ansicht nicht wirklich. Man erkennt das zum Beispiel daran, dass kürzlich ein mit unglaublicher Eile zusammengezimmertes Gesetz erlassen worden ist, in dem Insolvenzregeln abgeändert wurden. Dieses Gesetz ist übrigens gar nicht einmal ein so schlechtes. Es werden einzelne Maßnahmen aufgegriffen, mit denen man schon eine gewisse Erfahrung hat. Die meisten Zuhörer werden sich wahrscheinlich daran erinnern, dass es innerhalb der letzten 20 Jahre drei Flutkatastrophen in Deutschland gegeben hat, die eine jeweils riesengroße Notsituation hervorriefen. In Deutschland muss man normalerweise binnen drei Wochen einen Antrag auf Insolvenz stellen, nachdem die entsprechenden Voraussetzungen (Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung) eingetreten sind. In besagten Krisenfällen wurde diese Frist jeweils verlängert und teilweise sogar aufgehoben. Das macht man jetzt auch.
Ein anderes Beispiel ist die Finanzkrise 2008/09. Da hatte man einen Eröffnungsgrund für ein Insolvenzverfahren, der ökonomisch gesehen und abgefasst wurde. Diese Regelung war in den 90er-Jahren entworfen und nachgefasst worden und passte damals wunderbar. Als die Finanzkrise kam, merkte man aber plötzlich, dass dieser Tatbestand gewissermaßen ein Teilchenbeschleuniger für Insolvenzen ist. Das hätte zur Folge gehabt, dass 2008/09 praktisch die gesamte deutsche Wirtschaft ins Insolvenzverfahren hätte gehen müssen. Binnen drei Wochen wurde dieser Eröffnungsgrund damals aufgehoben. So etwas Ähnliches wird man auch jetzt machen, das ist momentan schon heftig in der Diskussion.
Mein persönliches Petitum vor diesem Hintergrund ist, dass man sich in Zukunft mehr Gedanken darüber machen muss, was die Voraussetzungen für die Maßnahmen sind, die jeweils unter erhöhtem Zeitdruck in Gesetzesform gegossen werden und sich speziell auf das Insolvenzrecht beziehen. Mit anderen Worten: Was sind die ökonomischen und was sind die sozialen Voraussetzungen, auf denen unser Insolvenzrecht basiert? Vermutlich wird jeder wissen, dass es beim Insolvenzrecht darum geht, dass man das Vermögen des Schuldners verkauft, um aus dem Erlös Geld herauszuholen, das man an die Gläubiger verteilt. Was ist aber, wenn es für diese Gegenstände keinen Markt gibt? Das ist eine schlichte Frage, die allerdings in meiner Wissenschaft nicht ernsthaft diskutiert wird. Wir kennen dieses Problem aus Griechenland und Süditalien. Wenn wir dort die Straße an der Küste entlangfahren, sehen wir immer wieder wunderschöne Areale, die durchbrochen sind von hässlichen, nicht fertiggebauten Gebäuden. Hinter diesen leeren Gerippen steckt jeweils ein Insolvenzfall, jemandes Hotel oder Hausmasse, die nicht fertiggestellt werden konnte, weil das Geld dafür nicht vorhanden war. Ein Insolvenzverwalter hat versucht, diese Anfangskonstrukte an irgendjemanden zu verkaufen, aber evidentermaßen hat er niemanden gefunden.
Das bedeutet also, dass wir ein Insolvenzrecht haben, das ins Leere läuft, weil es nicht auf den jetzigen Voraussetzungen basiert. Im Moment ist das große Problem unseres Insolvenzrechts, dass es möglicherweise anachronistisch, also nicht mehr zeitgemäß, auf die momentan massenhaft auftretenden Notfälle reagiert.
CMF: Man hätte dann wahrscheinlich schon in der Vergangenheit, nach der Flutkatastrophe ansetzen müssen. Aber das, was Sie jetzt gesagt haben, steht ja auch in engem Zusammenhang mit Solidarität. Lassen Sie uns zu dem Begriff kommen. Kann Insolvenzrecht diesem Grundwert unserer Zivilisation Geltung verschaffen, sowohl im Grundsätzlichen als auch in Krisenzeiten?
Читать дальше