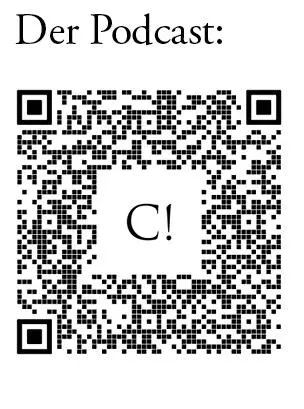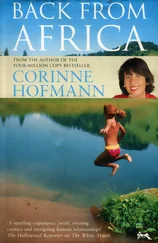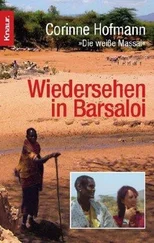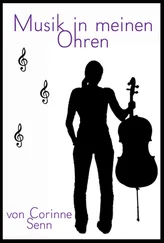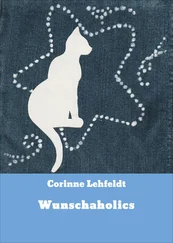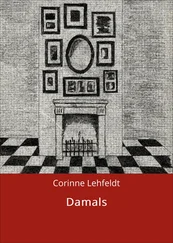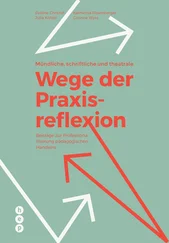CMF: Einerseits wollen wir uns jetzt wieder mehr auf das Regionale konzentrieren, andererseits wollen wir es aber auch schaffen, dass die Welt insgesamt mehr zusammenwächst, ein Einverständnis über Werte entwickelt und eine Art universale Zivilisation bildet.
TM: Auch hier gilt es, die Spannung aufrechtzuerhalten. Im Moment ist eine Wiederaufwertung des Regionalen unvermeidbar. Gleichzeitig kann es keinen Rückzug in Burgen und Festungen geben. Der Prozess der Globalisierung ist zu weit fortgeschritten, als dass man einfach Mauern hochziehen kann – weder um Flüchtlingsströme aufzuhalten noch um gewonnene Freiheiten zu beschneiden. Ein neues Maß zu finden, das wird die Herausforderung. Bald sprechen wir nicht nur von „Human Rights“, sondern auch von „Common Good Rights“, also Gemeinwohl-Rechten und -Pflichten. Inwieweit es gelingt, globale Institutionen zu bauen, bleibt abzuwarten. Vielleicht ist der aktuelle Druck dafür gut, um solche Schritte schneller zu gehen. Gleichzeitig würde ich immer wieder auf diesen einen Punkt zurückkommen, den wir uns in Europa so hart durch die Aufklärung erkämpft haben: Das Individuum in seiner Würde sollte im Mittelpunkt stehen, allerdings ohne es zu einer Selbstanmaßung und Hybris zu überhöhen. Raum für Individualismus ist nur möglich, solange es eine funktionierende Gemeinschaft gibt. Also: „Ohne Gemeinwohl keine Freiheit.“ Das so auszutarieren wird Globalisierungsprozesse nicht stoppen, aber zumindest in ein neues Licht rücken. Ich sehe die Chance, dass uns die Virus-Pandemie neuen Denkraum ermöglicht und die Einsicht wachsen lässt, dass wir es mit Systemen zu tun haben, die keiner mechanisch steuern kann, die sich wie die Evolution selbst organisieren und teilweise chaotisch entwickeln. Die Frage wird sein, wo die Eingriffspunkte sind, um eben nicht etwas autoritär mit Zwangsmaßnahmen durchzusteuern, sondern im Sinne einer neuen Form von „Softpower“, die es uns ermöglicht, in Frieden auf diesem Planeten weiter zusammenzuleben. Da stehen wir erst am Anfang der Überlegungen.
CMF: Der Aufstieg Europas und die Ausbreitung der abendländischen Zivilisation, die Sie mit der Aufklärung angesprochen haben, war eine jahrhundertelange Entwicklung. Stehen wir heute vor einem Wendepunkt?
TM: Ich möchte dafür werben, dass es keinen Wendepunkt gibt und dass wir die Stärken, die wir in Europa entwickelt haben, nicht einfach opfern dürfen. Stattdessen sollten wir versuchen, diese Stärken weiterzuentwickeln, und zwar unabhängig davon, dass Europa als Raum im globalen Wettbewerb zusammenstehen muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben. In Europa sind kulturelle Kräfte vorhanden, die sonst nirgendwo auf dem Planeten so sichtbar geworden sind. Ohne Zivilisationen gegeneinander aufzuwiegen, ist ein Europa der Vielfalt – geprägt von Entscheidungsprozessen, von Kriegs- und Demokratieerfahrungen – entstanden, welches einen Lernschatz beinhaltet, der durchaus zukunftsfähig ist. Mehr denn je hat die europäische Idee für mich Zukunft, wenn wir sie denn verantwortungsvoll weitertragen und uns nicht nehmen lassen, was schon erreicht wurde.
CMF: Wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist Ihre größte Befürchtung, und was Ihre größte Hoffnung?
TM: Meine größte Befürchtung ist, dass die Corona-Krise Entsolidarisierungseffekte zwischen den Generationen einleitet. Meine größte Hoffnung ist, dass es eine Einsicht in die gegenseitige Abhängigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft geben wird und damit verbunden auch eine gewisse Entschleunigung, ein Überdenken unserer Lebensformen und einen Umbau unserer Gesellschaft, bei dem die überleben, die wirklich zur Überlebensfähigkeit der Gesellschaft beitragen. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch manch Unsinniges im Alltag, was Konsum und das Anhäufen von Gütern betrifft, aufgeben – hin zu einer besseren Lebensqualität, die verträglicher mit der Umwelt umgeht. Das wäre meine größte Hoffnung: mehr Lebensqualität durch Mäßigung.
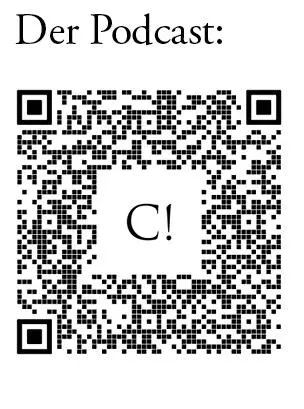
Zu diesem Thema:
Gespräch 2: Peter M. Huber
Gespräch 5: Monika Schnitzer
Gespräch 28: Udo Di Fabio
2.
Die freiheitliche Grundordnung unter Druck: Die Corona-Krise als Bewährungsprobe?
Corinne M. Flick im Gespräch mit Peter M. Huber, Richter des Bundesverfassungsgerichts im Zweiten Senat, am 5. April 2020
Corinne Michaela Flick: Im Moment erleben wir, dass unsere Freiheits- und Partizipationsrechte, die wichtigsten Errungenschaften unserer Zivilisation, in Reaktion auf die Corona-Pandemie eingeschränkt werden. Das ist die drastischste Einschränkung der Grundrechte in der Geschichte der Bundesrepublik. Kann man das so sagen?
Peter M. Huber: Das kann man ohne Weiteres so sagen. Das, was wir jetzt erleben, haben wir noch nie in vergleichbarer Weise seit 1949 erlebt. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass nur der Staat die Grundrechte garantieren kann. Der Staat hat a priori erst einmal die Aufgabe, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen. Er muss seine Bürger davor schützen, dass sie nicht von außen angegriffen werden, dass im Inneren keine Unruhen entstehen und natürlich auch, dass sie Krankheiten nicht zum Opfer fallen. Das ist in gewisser Weise die Voraussetzung dafür, dass man Freiheitsrechte überhaupt in Anspruch nehmen und ausüben kann. Wenn der Staat diesen Zweck verfehlt und hier krass versagen würde, wäre er vermutlich auch nicht in der Lage, auf Dauer unsere Freiheitsrechte zu garantieren.
CMF: Wird denn im Moment den rechtlich-normativen Fragen genug Aufmerksamkeit geschenkt?
PMH: Die Krise ist die Stunde der Exekutive. Dabei macht unser politisches Personal im Großen und Ganzen eine gute Figur. Dass man da nicht in erster Linie mit der abwägenden Waage eines Richters und eines Juristen herangeht, liegt in der Natur der Sache. Zunächst einmal muss gehandelt werden. Das bedeutet aber nicht, dass dabei keine Fehler passieren können. Nicht alles, was jetzt gemacht wird, ist über jeden rechtlichen Zweifel erhaben. Darüber wird man diskutieren und die Gerichte letztlich entscheiden müssen. Eine umfassende Bewertung wird erst im Laufe der Zeit möglich sein, vermutlich erst, wenn die akute Gefahr einmal gebannt ist. Die Diskussion findet schon heute statt: In der Frankfurter Allgemeine gab es Ende März einen Artikel von Christoph Möllers und Florian Meinel, die kritische Fragen an die Interpretation des Infektionsschutzgesetzes gestellt haben.1 Es gibt auch Gegenpositionen, aber die haben natürlich nicht dieselbe Präsenz wie in ruhigen Zeiten. Steile Thesen und Kritik ziehen mehr Aufmerksamkeit auf sich als eine behutsame Abwägung. Wie dem auch sei, eine rechtliche Debatte ist im Gange, aber die Aufarbeitung wird Jahre dauern. Jetzt muss der Staat erst einmal seine Ressourcen und Instrumente in die Hand nehmen, um unser aller Gesundheit und Leben zu schützen. Wenn er das nicht schafft, brauchen wir ihn nicht.
CMF: Sind wir vielleicht zu sehr an unsere Freiheitsrechte gewöhnt?
PMH: Wir haben beide das Glück gehabt, nie etwas anderes als diese Ordnung erlebt zu haben. Und diese Ordnung schreibt die Freiheit ganz groß, sie hat es vor der Corona-Krise getan, sie wird es nach der Corona-Krise tun und selbst in der Corona-Krise kann man sehen, wie Politiker darum ringen, wie viele Beschränkungen sie den Bürgern abverlangen können. Anders als in Frankreich oder in totalitären Staaten hat man nicht sofort rigorose Ausgangssperren verhängt, sondern erst mildere Mittel versucht. Je weniger diese gefruchtet haben, umso härter wurden dann die Maßnahmen. Dass sie teilweise wenig gefruchtet haben, liegt zum einen sicher daran, dass wir unsere individuelle – mitunter auch reichlich spießige – Selbstverwirklichung überziehen und verabsolutieren, zum anderen aber auch daran, dass man in ruhigen Zeiten aus dem Auge verliert, dass wir auf ein sozial verträgliches Zusammenleben angewiesen sind. Vielleicht ist das etwas, das man aus dieser Krise langfristig lernen kann: Die Freiheit ist zwar ein überragendes Gut, man darf sie jedoch nicht verabsolutieren, vor allem wenn es „nur“ verhältnismäßig schwache Positionen wie die Freiheit, ins Ausland zu reisen, betrifft. Die Verfassung macht das nicht; sie sieht – von der Menschenwürde abgesehen – jede Menge Beschränkungsmöglichkeiten vor. Den Müttern und Vätern des Grundgesetzes, die den Krieg hinter sich hatten, war klar, dass Freiheit nicht alles sein kann.
Читать дальше