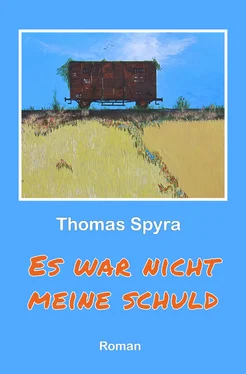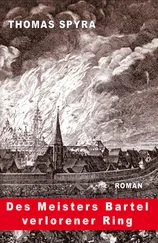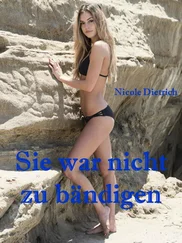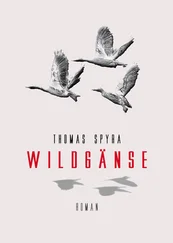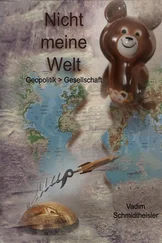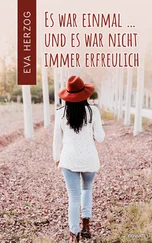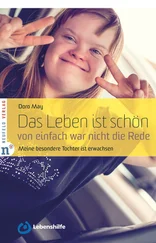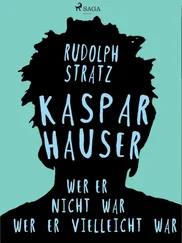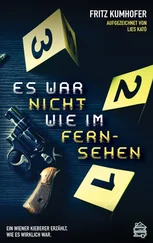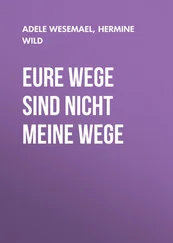«Ja, hast recht, war eine blöde Idee, hier über die Berge zu marschieren. Bei den paar Ausbesserungsarbeiten lernen wir nichts. Aber was solls, für den Winter reicht das und im Frühjahr ziehen wir weiter. Ich mach mir da keine Gedanken. Hauptsache, wir haben es warm, genügend zum Essen und zu Trinken», Johann hob sein Glas, prostete seinem Kameraden zu.
Glücklicherweise lernte er auf dem Markt in Bozen ein Fräulein Adam kennen, eine ältere Lehrerin, die ihm einige Bücher auslieh, sodass er die trostlosen Wintermonate lesend überstand.
Dann Ende Februar, die Temperaturen kletterten auf zehn Grad, juckte es die Burschen, sie wollten weiter ziehen.
«Bleibt noch einen Monat, ihr kommt noch nicht über die Berge, zu viel Eis und meterhoher Schnee.»
Johann überlegte, der Meister meinte es gut mit ihnen.
Bertram hatte die Warterei satt: «Dann wandern wir eben nach Süden.»
«Ohne mich, die sprechen dort Italienisch, da verstehe ich nur Bahnhof», wehrte er ab.
Sie wurden sich nicht einig, jeder verfolgte seinen eigenen Weg.
Bertram zog nach Süden und Johann wartete ab.
Ende Mai fuhr er auf einem Bauernkarren in München ein. Hier traf er in der Herberge auf Hannes aus Stettin, der bereits im Oktober wieder ins Bayerische zurückgewandert war.
«Komm mit, in Landshut gibt es einen Betrieb der Leute für eine große Baustelle sucht.»
«Ich brauche mal Ruhe nach dem anstrengenden Weg über die Alpen», verabschiedete er sich von Hannes, «Ich suche mir etwas hier in der Stadt.»
Johann entschied sich für einen kleinen Bauhof im Nachbardorf von Dachau, die bauten eine Kirche. Nichts Spektakuläres, aber eine kontinuierliche Arbeit.
«Ich verstehe euch nicht, euer Dialekt ist für mich unverständlich. Da hätte ich gleich Richtung Italien ziehen können», lachend fragte er immer wieder seine Arbeitskollegen, ließ sich übersetzen, was sie meinten.
Die urige bayerische Mundart, die auf dieser Baustelle gesprochen wurde, übertraf alles, was er bisher gehört hatte.
Im Sommer, nach Ende der Arbeiten an der kleinen Kirche, wanderte er weiter über Nürnberg und Berlin hinauf bis Stettin.
Hier traf er wieder auf Hannes, der hatte ihm geschrieben und einen Arbeitsplatz bei seinem Meister vermittelt. Hannes war bereits ein Einheimischer, das heißt, er war mit der Walz zu Ende. Gemeinsam arbeiteten sie an einem großen Backsteinlagerhaus am Hafen.
Eines Tages fragte ein kleiner drahtiger Mann auf der Baustelle: «Hat von euch Fremden Gesellen der eine oder andere Interesse an großen Backsteingebäuden? Ich habe einen Auftrag und nehme gerne noch ein paar fleißige Maurer mit.»
Für Johann war dies ein Anstoß erneut loszuziehen. Der Meister und er wurden sich einig. So packte er die günstige Gelegenheit beim Schopf und bestieg gemeinsam mit fünf weiteren Gesellen das Hanseschiff nach Königsberg.
Meister Wolfgang Hagedorn hatte im neu eröffneten Hafen der ostpreußischen Stadt, am Seekanal drei große Baustellen. Im Hafengelände bauten sie Werfthallen und Speicher- gebäude, diese wurden alle im modischen Stil der Zeit, der sogenannten Neo-Renaissance [Fußnote 14] , errichtet.
Das war nach Johanns Geschmack, endlich konnte er einmal seine Fähigkeiten anwenden und lernte viele Tipps dazu.
Aber mit der Zeit wurde selbst das Mauern von Friesen und Bögen eintönig.
«Johann, du sollst dich morgen früh beim Zunftmeister melden.»
«Danke, Meister Hagedorn!»
«Weißt du, was der von dir will?»
«Ja, es ist bestimmt wegen meiner Wanderzeit, die ist nächsten Monat zu Ende.»
«Was schon? Ich hoffe, du bleibst trotzdem hier.»
Endlich, nach drei Jahren und einem Tag, erlaubte die Zunftordnung die Heimreise.
Er verbrachte noch einmal, wie so oft, seinen Feierabend am Strand und schaute aufs Haff hinaus, der Wind blies ihm Sand in die tränenden Augen.
Seine Eltern waren beide vor etwa zwei Jahren kurz hintereinander gestorben. Damals hatte ihm dies die älteste Schwester Frieda aus Nürnberg in einen Brief geschrieben. Dort hatte sie Arbeit und einen Mann gefunden. Sie berichtete auch, dass Sabine, die Jüngere, mit Rudolf, einen Klassenkameraden von Johann, nach Amerika aus- gewandert sei.
Als Geselle auf der Walz hätte er zwar das Recht gehabt, zur Beerdigung zu fahren, aber der Brief war ihm fast fünf Wochen hinterhergereist. So verzichtete er damals notgedrungen auf die anstrengende weite Reise. Er hatte nie ein gutes Verhältnis zu seinem Vater, aber, dass er ihn und vor allem die Mutter niemals wieder sehen sollte, hatte ihn traurig gestimmt.
Voller Tatendrang hatte er sich auf die Wanderschaft begeben. Weit war er mit seinen zwanzig Jahren herumgekommen, von Oberschlesien nach Böhmen, dann mit einer kleinen Gruppe bis Bozen, weiter über Stettin nach Königsberg. Gerne arbeitete er auf fremden Baustellen, begierig etwas Neues zu erlernen oder seine Fertigkeiten zu zeigen. An die Gesellentraditionen, wenn sie auf dem Krug , der Herberge waren, wie zum Beispiel Rundschnack[Fußnote 15] , Klatschen[Fußnote 16] , Schallern[Fußnote 17] oder Trudeln[Fußnote 18] , gewöhnte er sich nie, das endete meist in einem gewaltigen Trinkgelage, war immer fremd für ihn geblieben.
Sein Vater war ein Trinker gewesen, Johann hatte erlebt, was passiert, wenn ein Mann betrunken war. Er mied den Alkohol so weit wie möglich.
Immer wieder fragte er sich, ob er das langweilige Dasein zu Hause aushalten würde. Erst einmal schauen, was das Leben bereit hält, sprach er sich Mut zu.
Er war gerne unterwegs gewesen, hatte neue Menschen kennengelernt, war frei – oder? Ist man eigentlich je frei? Nicht immer war er einer Meinung mit seinesgleichen. Auch musste er sich an die Handwerksordnung halten, sich einem fremden Meister unterordnen. Freilich hatte er das Recht, jederzeit weiterzuziehen.
Quer durch Polen war er gewandert, er freute sich, aufs Neue in heimatlichen Gefilden zu sein, seit Posen sprach man wieder deutsch. Das Land wurde flacher – grüne und braungelbe Ebenen, so weit das Auge reichte. Wogende mannshohe Weizenfelder, leuchtendes Gelb, ein Brummen und Surren der schwirrenden Insekten.
«Ja, das ist Heimat! Anders als in Bozen, mit den hohen Bergen, schneebedeckten Gipfeln und den Weinhängen.»
Unter einem schattenspendenden Baum rastete er, verzehrte seine letzten Vorräte.
Von irgendwoher schlug eine Glocke die vierte Stunde, er sprang auf, war er doch ein wenig eingedöst: «Nun aber schleunigst los. Heute Abend will ich zu Hause sein.»
Er sprach auf den langen, hier in Polen menschenleeren einsamen Marschstrecken mit sich selbst, er musste sich hören. Mitunter sang oder pfiff er laut vor sich hin, aber er war so unmusikalisch, dass ihn sogar das Zwitschern der Feldlerchen aus Melodie und Takt warfen. Arg war es an Gesellenabenden, wenn man ein Lied anstimmte, er beherrschte zwar sicher den Text, aber sang mit voller Überzeugung falsch.
Mit großen Schritten setzte er seinen Weg fort, nach einer Weile stoppte er.
«Wohin führt mein Weg, zu wem will ich?» Seine Eltern waren gestorben, die Schwestern weit weg und andere Verwandtschaft war ihm nicht bekannt, außer dem aufgeblasenen Schulze. Traurigkeit überfiel ihn, er hatte niemanden mehr, zumindest wusste er von keinem.
Nach einem kräftigen Schluck aus der Wasserflasche hängte er sich seinen Charlottenburger um, nahm den Stenz und marschierte weiter:
Es, es, es und es,
es ist ein harter Schluss
weil, weil, weil und weil,
weil ich aus Frankfurt muss!
Drum schlag ich Frankfurt aus dem Sinn
und wende mich, Gott weiß, wohin.
Ich will mein Glück probieren, marschieren. …
Читать дальше