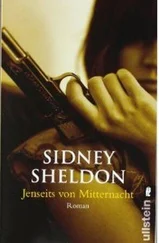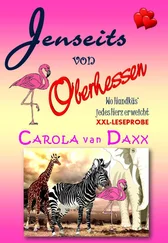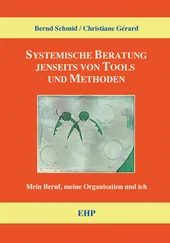»Ja, das ist so.«
»Dies ist durch den zuständigen Minister nicht geschehen. Er hat lange gezaudert. Wichtige Zeit ist verloren gegangen, in der unsere Soldaten bis an die Grenze ihrer Möglichkeiten im Dauereinsatz waren.«
Der Instrukteur wusste genau, dass der Mann, der ihn nun vor versammelter Mannschaft in Verlegenheit brachte, recht hatte. Immer wieder hatten die Kommandeure das Ministerium in Berlin davon unterrichtet, dass die Zahl der Soldaten in Afghanistan nicht annähernd ausreiche.
»Mein Bruder sagte, sie haben so manchen Auftrag nicht oder nur bedingt erfüllen können, weil sich das Einsatzkontingent während des ganzen Einsatzes an seiner Belastungsgrenze befand.« Völlig unbemerkt war ein Oberstleutnant hereingekommen, hatte sich in die hintere Reihe gesetzt und eine Weile zugehört. Jetzt schien ihm die Diskussion zu weit zu gehen.
»Ich denke, wir sind nicht hier, um über die Möglichkeiten, über genutzte und ungenutzte Chancen zu diskutieren«, sagte er. »Sie sollen hier auf den Einsatz vorbereitet werden. Und dazu ist genau das Papier wichtig, das der Leutnant Ihnen gerade erklärt.« Er schaute den Instrukteur an. »Fahren Sie fort!«
*
Am Morgen des kommenden Tages ließ Senz sich von seinem Handy wecken. Nun wäre er an der Reihe gewesen, mit lautem Ruf durch den Flur die Kameraden zu wecken. Alles, was er herausbrachte, war ein leises Krächzen. Er ging zurück und weckte Adam Silarski.
»Ich kann das nicht, Adam«, sagte er. »Ich kann nicht so schreien, dass die Jungs das hören.«
»Musst du mich wecken? Ich habe gerade so schön geträumt. Hast du gar kein Selbstvertrauen? Stell dich hin und schreie, was das Zeug hält.«
»Ich kann das nicht.« Senz war den Tränen nahe.
Adam schälte sich mühsam aus seinem Bett. Gemeinsam gingen sie vor die Tür und Silarski forderte Christoph Senz auf, es nochmals zu versuchen. Wieder war Senz nur in der Lage, ein leises Krächzen abzugeben, und so übernahm Silarski es wieder, laut schreiend die Kameraden zu wecken.
»Auf-ste-hen! Auf-ste-hen! Alle auf-ste-hen!« Er zeigte auf den leeren Blechkübel. »Und nun, Christoph, wirf den Kübel durch den Flur!«
Senz hob den Kübel an, und während Silarski wieder »Auf-ste-hen! Auf-ste-hen! Alle auf-ste-hen!«, schrie, warf er den Kübel zaghaft in den Flur.
»Glaubst du, dass es Zweck hat, wenn ich dem Arzt heute sage, ich sei schwul?«, fragte Senz Silarski.
»Warum? Bist du denn schwul?«
»Nein. Ich will aber unbedingt ausgemustert werden.«
»Wenn der Arzt selbst schwul ist, wird er den Wink verstehen und es möglicherweise machen. Jedenfalls dann, wenn er dich als Homosexuellen erkennt. Wenn nicht, sehe ich schwarz, weil er dann denkt, du hättest seine Homophilität erkannt und wollest das ausnutzen. Und den stinknormalen Ärzten ist es scheißegal, wen sie diensttauglich schreiben. Da wird das ohnehin nicht ziehen.«
»Ich habe gestern noch einmal mit meinem Onkel gesprochen, der Allgemeinmediziner mit eigener, großer Praxis in Mecklenburg-Vorpommern ist.«
»Hat es etwas gebracht?«
»Nein. Er sagte nur, wenn der Arzt vom Psychologischen Dienst gut sei, würde er meinen Zustand erkennen. Auf das angebliche Schwulsein solle ich lieber verzichten.«
»Na, siehst du.«
Inzwischen zeigte das »Unternehmen Weckruf« Erfolg. Die ersten Rekruten gingen zum Waschraum. Silarski und Senz zogen sich in den Raum 113 zurück.
*
Nach dem Frühstück gingen Graber und Jerôme Mohr hinunter zum Tor, wo bereits ein Wagen der Fahrbereitschaft auf sie wartete; täglich fuhr dieses Fahrzeug zwei, drei Rekruten zum Psychologischen Dienst der Bundeswehr nach Leipzig, wo ein Psychiater sich mit den Männern unterhielt. Geprüft wurde unterschiedlich. Ob überhaupt diensttauglich bei den neu eingezogenen Rekruten, die ihre Erstausbildung erhalten sollten, ob den psychischen Anforderungen beim Dienst in Afghanistan gewachsen bei den Männern, die für diesen Einsatz aus anderen Standorten hier zusammengezogen wurden.
Christoph Senz wurde zu einem Militärarzt im Majorsrang gebracht. Nach der Begrüßung schaute ihn der Mann eine ganze Weile an, ohne etwas zu sagen. Dabei beobachtete er sehr genau, wie unsicher sich Christoph Senz an den Fingern spielte und hörte das leichte Zittern in der Stimme, als er ihn fragte, wie er sich fühle.
»Erzählen Sie mir etwas über Ihre Jugend, Herr Senz.«
»Wo soll ich anfangen?«
»Am besten, wie weit ihre Erinnerungen an die Kindheit haften geblieben sind.«
»Ich weiß, dass meine Eltern sich trennten, als ich zwei Jahre alt war. Aber daran habe ich keine realen Erinnerungen mehr.«
»Sie wissen es von Ihrer Mutter?«
»Ja.«
»Waren Ihre Eltern verheiratet?«
»Nein. Sie haben nur zusammengelebt. Zuerst habe ich meinen Vater auch gar nicht vermisst. Wenn ich es recht bedenke, später auch nicht wirklich. Als ich klein war, haben sich meine Mutter und in den Ferien meine Großeltern liebevoll um mich gekümmert. Ich weiß noch, wie ich mein erstes Fahrrad bekam. Es war eins mit Stützrädern, weil ich eigentlich noch viel zu klein war, um mit einem solchen Rad in der Gegend herumzufahren. Aber ich wünschte mir nichts sehnlicher als ein Rad.«
»Wenn Ihnen die Sache mit dem Rad so in Erinnerung geblieben ist, werden Sie sicher schildern können, wann und wie Sie es bekamen?«
»An Feiertagen fuhren wir immer mit der Bahn von Berlin, wo meine Mutter mit mir wohnte, zu einem kleinen Ort im heutigen Brandenburg, der an das Braunkohlefördergebiet grenzte. Mein Großvater war dort als Chefarzt in einem Krankenhaus tätig, das vorwiegend für die in der Kohle arbeitenden Menschen betrieben wurde. Wenn wir ankamen, stand mein Opi schon am Bahnsteig. Er konnte es gar nicht erwarten, mich in seine Arme zu nehmen.«
»Sie fuhren gern zu Ihren Großeltern …«
»Sehr gern. Jedes Mal, wenn meine Mutter Ferien hatte. Und dann kam das Ereignis – wir stiegen in sein Auto, einen Trabant. Ich liebte das kleine Auto, das mächtig knatterte und erbärmlich nach dem verbrannten Öl stank. Es war jedes Mal ein Erlebnis für mich kleinen Mann. Wenn wir wieder nach Hause fahren mussten, habe ich immer geweint. Viele Jahre habe ich geweint, wenn ich wieder von meinen Großeltern aus der behüteten ländlichen Gegend ins kalte Berlin fahren musste. Auch als ich schon größer war.«
»Das zeugt von einer engen Bindung an Ihre Familie. Kommen wir auf das Rad zurück.«
Christoph Senz merkte gar nicht, wie der Arzt versuchte, ihn mit diesen Fragen locker zu machen. Der Mann hatte genau den Ton getroffen, der bei Christoph ankam, der ihm Vertrauen gab, sich ein wenig zu öffnen.
»Das Rad. Ich hatte es bei einem anderen Kind in Berlin gesehen«, sinnierte Christoph Senz. »Es war relativ klein und hatte Stützräder an beiden Seiten, damit man nicht umfallen konnte. Ich sehe es noch heute vor mir, als wäre es erst Stunden her. Der Junge in Berlin ließ mich widerwillig für einen Augenblick auf sein Fahrzeug steigen, fing aber wie wild an zu brüllen, als ich nicht bereit war, es nach wenigen Sekunden schon zurückzugeben. Er hörte erst auf zu weinen, als es mir weggenommen wurde, und ich heulte los, weil ich es nicht herzugeben bereit war. Aber nichts half. Der Junge bekam sein Rad zurück und ich wünschte mir seither nichts sehnlicher, als ein solches Fahrrad zu besitzen.« Christoph sah, wie der Major sich hin und wieder Notizen machte. Daneben hatte er noch einen Bogen liegen, auf dem sicher irgendwelche Fragen aufgelistet waren, denn auf diesem Bogen machte der Arzt nur ab und zu ein Kreuz.
»Ich weiß nun aus den Erzählungen, dass meine Mutter, die als Lehrerin in Berlin tätig war, versuchte, ein solches Kinderrad zu bekommen. Vergeblich. Es war ein Artikel, der zu dieser Zeit im Wirtschaftsgüter-Mangel-Land DDR kaum aufzutreiben war. Mein Großvater erzählte einem Patienten, wie dringend er ein solches Rad für seinen Enkel suche. Und dieser Patient hatte Zugang zum Rat der Stadt. Er besorgte meinem Großvater das Fahrrad.«
Читать дальше