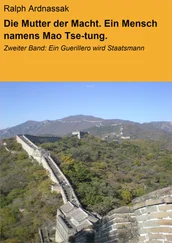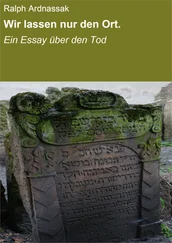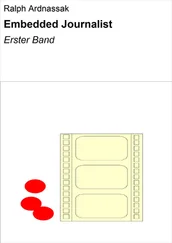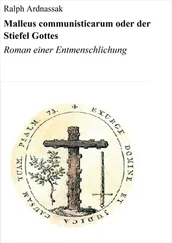Die Anderen, das seien die sogenannten Besser-Wessis, die sie gelegentlich treffe, antwortete sie. Beispielsweise diese arroganten Bayern, im Grunde Hinterwäldler, die frühmorgens schon ihr Hefeweizen tranken und regelmäßig zur Beichte liefen und die sie allen Ernstes gefragt hatten, ob sie denn als Ostdeutsche überhaupt wisse, was Bananen seien und wie man diese vor dem Genuss schälen müsse.
Was ihrer Meinung nach denn der auschlaggebende Unterschied zwischen Ossis und den Wessis sei, fragte der Reporter jetzt.
„Ich will das mal an einem Beispiel illustrieren!“, lautete ihre Antwort: „An einem Beispiel aus meinem Arbeitsleben im Textil-Einzelhandel!“
„Gut!“, sagte der Reporter vom SPIEGEL: „Dann illustrieren Sie das mal!“
„Ich hatte mal eine Chefin, die kam aus dem Westen und war unsere Filialleiterin. Also die war weder verheiratet, noch hatte sie Kinder und beides stand auch nirgendwo in ihrem Lebensentwurf verzeichnet! Die trug stets die teuersten und die schicksten Klammotten und fuhr einen 3er-BMW, ein Cabrio. Wenn sie abends nach Hause kam, dann war sie allein und trank aus lauter Frust vorm Fernseher eine ganze Flasche Rotwein aus. Und wenn sie dann doch mal einen Kerl abschleppen konnte, dann hielt das nie länger als höchstens eine einzige Woche. Ich glaube, ihr ganzes verkorkstes Leben stand im Grunde doch nur auf zwei Beinen, nämlich auf Geld und Karriere!“
„Und Sie?“, fragte der Reporter: „Welches Karriereziel haben Sie überhaupt?“
„Maximal Abteilungsleiterin in einem Kaufhaus!“, lautete ihre Antwort: „Da verdient man schon ganz gut und hat abends dann irgendwann auch tatsächlich mal Feierabend!“
Bei der Wahl zur Miss Sachsen-Anhalt präsentierte sie im ersten Durchgang ein Abendkleid, dann Bademoden des Veranstalters Miss Germany Corporation. Sie belegte den dritten Platz.
Ein toller Gang, Natürlichkeit und das mysteriöse und nicht näher zu quantifizierende „gewisse Etwas“ seien die unerlässlichen Voraussetzungen, um eine Miss zu werden, so die Jury.
Vom Laufsteg führte sie ihr Weg schließlich direkt in diese Klinik, nachdem ein hartnäckiger Husten nicht weichen wollte, ein quälender und angsteinflößender Husten, der sie am Ende sogar Blut spucken ließ.
Man sprach in ihrem Fall von einer nicht mehr kurativen, sondern rein palliativen Chemotherapie, deren Behandlungsdauer, im Hinblick auf die toxischen Nebenwirkungen des Medikaments, auf höchstens vier bis sechs Zyklen zu beschränken seien. Obschon es hierzu keine signifikanten Studien und keine allgemeingültigen klinischen Empfehlungen gab, galt offensichtlich auch auf der Onkologie unseres Klinikums der eherne Grundsatz: Lebensqualität geht vor künstlich erzwungene Lebenszeit.
Meine Frau und meine Schwiegermutter trafen in der Klinik ein, wort- und tränenreich, wie an jedem Nachmittag. Besonders meine Frau litt unter dem Zustand ihres Vaters, den sie stets als entschlossenen und mit beiden einen fest im Leben stehenden Vater erlebt hatte. Als einen Mann, der eine Aura der Unbesiegbarkeit und heiteren und warmherzigen Stärke um sich herum verbreitet hatte.
Nun aber saß er, praktisch hilflos und stimmlos, im Garten der Klinik, dazu verdammt, dutzende von Medikamenten an jedem Tag einzunehmen und auf die Vorschläge der Ärzte für eine Behandlung des Tumorleidens zu warten, welches sich definitiv bereits in seinem Endzustand befand.
War meine Frau vor der Erkrankung ihres Vaters mir gegenüber bereits kritisch und rechthaberisch gewesen, die mir ihre Meinung und ihre Vorstellung davon, wie die Dinge zu sein hatten, aufzwang, so schien sich dieser Zustand nun noch einmal beträchtlich zu verschärfen.
Zu der Angst, meinen Job in der Klinik zu verlieren, gesellte sich eine beinahe kindlich-naive Sorge, möglicherweise auch noch meine Frau zu verlieren, obwohl ein Teil von mir sagte, dass mit dem Verlust der Frau zumindest auch der Verlust von Gängelei und häuslichem Streit verbunden wäre.
Die Obsession, mit der sich mich zu Hause verfolgte, alles, was auch immer ich tat, aggressiv und lautstark kritisierte, nahm allmählich groteske Züge an. Alles was ich tat oder unterließ, wurde durch sie kritisiert. Vor allem machte ich, ihrer Meinung nach, die Wohnung grundsätzlich böswillig schmutzig und tat überhaupt alles nur Denkbare, um ihre Wünsche und Anordnungen ab absurdum zu führen und zu umgehen.
Selbst in Räumen unserer gemeinsamen Wohnung, die ich stunden- oder sogar tagelang nicht mehr betreten hatte, nachdem sie zuvor exzessiv von mir gesäubert worden waren, fand sie angeblich Berge von Schmutz und Dreck, die ich dort in unzweifelhaft böswilliger Absicht hinterlassen hatte.
Für die banalsten Dinge in der Wohnung, etwa für die Einstellungen der Thermostate an den Heizkörpern, entwickelte sie Vorschriften und Abläufe, die sie tagtäglich mehrmals auf ihre korrekte Einhaltung kontrollierte.
Dinge, die nicht ihren Vorstellungen entsprachen, führten unverzüglich zu Anfällen einer geradezu erschreckenden Art von Tobsucht.
Ich litt unter der Missachtung und Ungewissheit in der Klinik und unter der Herrschsucht meiner dominanten Frau.
Mein Schwiegervater hatte sich angewöhnt, angesichts meiner täglichen Besuche, nach meinem Befinden zu erkundigen, so wie ich mich nach seinem.
Selbst die Patienten bekamen einiges von den Spannungen mit, die hier zwischen dem Personal und der Klinikleitung herrschten. Es schien, als ob sich die verzweifelt-angespannte Stimmung, in der wir als mittleres medizinisches Personal täglich bis zur Erschöpfung arbeiteten, auch auf die Patienten übertragen würde.
„Du musst Dich dagegen wehren, Junge!“, krächzte mein Schwiegervater be dieser Gelegenheit immer wieder, nachdem er sich zuvor versichert hatte, dass niemand sonst in der Nähe war: „Du kannst Dich doch nicht Dein ganzes Arbeitsleben lang nur herum schubsen lassen! Ich habe mich doch schließlich auch gewehrt bei der BauBiGe gegen einen Herrn Kramer Senior!“
„Ich muss mich wehren!“, wiederholte ich leise und es klang irgendwie, als sei ich geistig abwesend.
„Jawohl1“, flüsterte mein Schwiegervater, nahm das schmale Glas mit dem Mineralwasser zwischen Daumen und Finger seiner rechten Hand, führte es langsam und mit leisem Zittern zum Mund, so dass mich bereits die Fragilität dieser kleinen Geste erschütterte und trank in winzigen Schlucken daraus.
Ich hätte ihm sein Leiden nicht nur gern erleichtert, ich hätte es ihm sogar vollständig abgenommen und mit ihm die Rolle getauscht, wäre dies möglich gewesen. Es war keineswegs Schwatzerei, sondern eine Art von tiefer Verzweiflung, in der ich über diese Unmöglichkeit nachdachte, so wie vielleicht jemand, der Südfrankreich unendlich liebte und der doch für sich selbst erkennen musste, dass er nie ein Häuschen in der Provence besitzen konnte.
Ich konnte mit ihm nicht die Rolle tauschen, des war das Schicksal, dies war das Leben! Und so musste er unheilbar krank und leidend, aber geliebt bleiben; während ich gesund, aber gehasst bleiben musste.
Meine Frau störte zu Hause inzwischen bereits meine schiere Anwesenheit und Existenz und ich konnte mich nur bemühen, mich stimmlos und widerspruchslos und möglichst auch körperlos zu machen, um die Wucht ihrer bösartigen Ausbrüche dadurch nicht weiter zu steigern.
Ich musste zu einem Schatten meiner selbst werden, der möglichst unauffällig, ohne Stimme, ohne Willen und ohne Bewegung, existierte; wie ein Tier im Dschungel, direkt unter den Augen des Jägers, das nur überleben konnte, wenn es bewegungslos wurde und wenn es bewegungslos zwischen den Blättern und Lianen verharrte.
Bewegungs- und Stimmlosigkeit waren die ersten und unerlässlichen Voraussetzungen für den Erhalt meiner Ehe und die Notwendigkeit, nirgends in den Räumen auch nur die aller kleinsten Zeichen meiner körperlichen oder geistigen Existenz zu hinterlassen.
Читать дальше