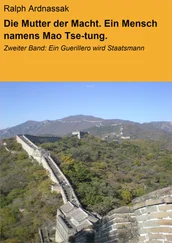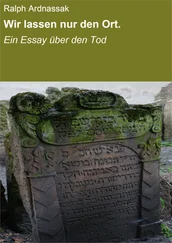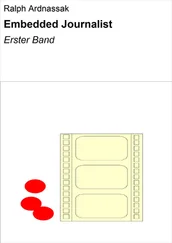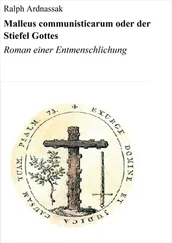Am Tag, bevor die Biopsie stattfinden sollte, saß ich mit ihm unten, auf der Wiese, vor der großen Freitreppe der Klinik. Hinter unseren Rücken erstreckte sich halbkreisförmig die gewaltige und altehrwürdige Fassade der Klinik. Wir saßen an einem Tisch unter einem bunten Sonnenschirm und blickten über die grüne Wiese, die erst am Tag zuvor gemäht worden war und die nach frisch gemähtem Gras duftete.
Aus der Ferne war gedämpft das Zischen eines Gartenschlauches zu hören, mit dem ein Gärtner die Wiese sprengte, um ein Verdorren der kurzen Grasnarbe bei den hochsommerlichen Temperaturen zu verhindern.
Wir saßen dort und wir warteten auf meine Frau und auf meine Schwiegermutter, die am Nachmittag mit dem Auto kommen wollten.
Ich spürte seine Angst vor der Biopsie am nächsten Tag und ich wusste, ich würde ihm diese Untersuchung, die durchaus ihre Risiken barg, wie jeder unter einer Narkose durchgeführte Eingriff, nicht abnehmen, noch ihm die Schmerzen, die es hinterher geben würde, erleichtern können.
Die Banalität und Oberflächlichkeit aller Beziehungen, wie sie Menschen untereinander, selbst innerhalb der Familie, eingingen, kam mir plötzlich zu Bewußtsein. Er würde morgen die Biopsie über sich ergehen lassen müssen und wir, seine Angehörigen, konnten nichts weiter dabei tun, als ihm alles Gute zu wünschen und Plattheiten mitzuteilen. Verdammt wenig, wie ich plötzlich fand. Zu wenig, für den Anspruch menschlicher Bindungen, dachte ich mir.
Also saßen wir, blickten über die Wiese und blinzelten in der Sonne und ich fragte ihn nun wohl schon das zehnte Mal, ob er auch keine Schmerzen habe und wie ihm das Mittagessen bekommen sei, als er mich plötzlich ansah und mit sehr großer Bestimmtheit in seiner immer wieder versiegenden Stimme krächzte: „Ich will eine Pistole haben!“
Ich nickte wortlos, obwohl ich hätte erschrecken müssen. Aber ich nickte nur wortlos, weil ich diesen Satz zutiefst verstand, nicht seiner Aussage wegen, sondern weil ich meinte, den Grund für diesen Wunsch sehr gut zu kennen, der wiederum in der Essenz des Schreibens von Elias Canetti zu finden war, wonach der Tod die Quelle für jeden Antrieb eines Menschen sei.
Wieder blinzelten wir und starrten schweigend über die Wiese, über der jetzt in der Hitze des Mittags ganze Schwärme von Mücken tanzten, während sich in dem Wasserstrahl des Gartenschlauches, mit dem die kurze Grasnarbe der Wiese vor der Fassade der Klinik gesprengt wurde, ein winziger und ein wenig rudimentärer Regenbogen bildete, dessen Farben ich deutlich sehen konnte.
Ich spürte meine Hilflosigkeit und Ohnmacht angesichts seiner Krankheit und ich sah all die blauen Flecken an seinen Armen, die Pflaster in seiner Armbeuge, wo sie Zugänge gelegt hatten und den zentralen Venenkatheder, den mehrlumigen ZVK, das System seiner dünnen und farbigen Kunststoffschläuche, welches sie ihm wie üblich in die Vena jugularis interna am Hals eingeführt hatten, von wo die bunten Schläuche nun herab baumelten und ihm das Aussehen eines Indianerhäuptlings gaben, der seinen Kriegsschmuck am Hals angelegt hatte.
Ich sah ihn dort sitzen und blinzelte in das grelle Sonnenlicht. Er aber sah mich direkt an und krächzte noch einmal und mit Nachdruck, wobei er, wie zur Bekräftigung des Gesagten, dabei mit dem Kopf zu jedem gesprochenen Wort nickte: „Ich will eine Pistole haben! Eine richtige, eine scharfe Pistole!“
+++Ebola-News-Ticker+++Ebola-News-Ticker+++Ebola-News-Ticker+++Ebola-News-
Ban Ki Moon, Generalsekretär der UN, besucht die Ebola-Gebiete in Westafrika und mahnt dabei die Einhaltung elementarster Hygieneregeln an, was zur Eindämmung der Seuche beitragen soll.
Nicht nur medizinisches Personal, welches Kontakt mit Infizierten hat, ist besonders gefährdet, sondern vor allem auch Leichenbestatter.
Kulturelle Traditionen und Gebräuche, insbesondere bei der Bestattung von Ebola- Infizierten, müssten den Hygienevorschriften weichen. Dies forderte auch Generalsekretär Ban Ki Moon bei seinem Besuch in den betroffenen Gebieten Westafrikas.
Gerade bei der rituellen Waschung der Toten vor der Beisetzung bestünde aller höchste Infektionsgefahr, so Ban Ki Moon.
Wer an Ebola verstorbene Personen wasche, trage damit massiv zur weiteren Verbreitung der Seuche bei.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO plant indes, Überlebende der Ebola-Seuche als medizinisches Personal einzusetzen. Zwar sei dies noch nicht durch Fakten belegt, doch könne man davon ausgehen, dass Infizierte, die die Krankheit überstanden hätten, gegen eine neuerliche Infektion immun seien.
„Sieh mal, dort drüben!“, krächzte mein Schwiegervater und wies, um nicht unnötiges Aufsehen durch eine Geste mit der Hand zu erregen, lediglich mit einer kurzen und nickenden Bewegung in Richtung auf die frisch gemähte Wiese vor der Klinik: „Der Tod respektiert tatsächlich weder Jugend noch Schönheit!“
Ich blickte in die Richtung, die er mit seinem Kopfnicken bereits angedeutet hatte. Dort, abseits vom Trubel der Besucher, die mit ihren kranken Angehörigen an den Tischen unter den bunten Sonnenschirmen aßen, Kaffee tranken und schwatzten, im Schatten einer gewaltigen und offensichtlich uralten Lärche, eine junge, schlanke und auffallend hübsche Frau mit langem glatten blonden Haar ganz einsam in einem der weißen Plastikstühle der Cafeteria. Sie hatte uns den Rücken zugekehrt und las in einem bunten Magazin.
Der Jogginganzug und die Badelatschen, die sie trug, wiesen sie ganz eindeutig als Patientin dieser Klinik aus.
„Das ist Sabrina Höhn!“, krächzte mein Schwiegervater: „Ist noch keine 34 Jahre alt und war schon Miss Sachsen-Anhalt!“
„Was hat sie denn?“, fragte ich, denn ich kannte im Grunde nur die Patienten von unserer Station mit Namen und Angesicht.
„Krebs!“, flüsterte mein Schwiegervater und es klang einsilbig und resigniert: „So ein hübsches Ding und hat tatsächlich Krebs! Lungenkrebs im Endstadium, genau wie ich!“
Sabrina Höhn kam aus dem Thüringischen. Zum Zeitpunkt der politischen Wende in der ehemaligen DDR war sie gerade einmal ganze 9 Jahre alt gewesen.
Nach dem Abitur war Sabrina Höhn in die Stadt gekommen, um hier an der Universität Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau hatte sie bereits daheim in Thüringen absolviert.
Um sich ihr BAföG aufzubessern, arbeitete sie im Callcenter der renommierten Lokalzeitung in der Anzeigenabteilung.
Ihre Freizeit verbrachte die zierliche Studentin in den verräucherten Diskotheken und Studentenclubs der Stadt, in denen die Luft so beißend und dick war, dass man sie förmlich schneiden konnte.
Sie war 19, Einzelhandelskauffrau in einer großen Modekette in einer Kleinstadt in der Nähe und Stammgast in den Nikotin und Nebelschwaden der bekannten Diskothek „Holiday“, als sie dort an einem Sonntagmorgen, um exakt 2:32 Uhr, von einer regionalen Agentur entdeckt wurde, die Misswahlen veranstaltete.
Sabrina Höhn wurde Miss Torgau und damit Kandidatin der Wahls zur Miss Sachsen-Anhalt, bei der sie sich zur Miss Deutschland qualifizieren konnte.
Natürlich war sie ungemein stolz, hatte all diese Geschichten von Claudia Schiffer und anderen Models im Hintergrund und wollte ganz selbstverständlich Miss Deutschland werden.
Der Reporter des Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL, der sie interviewte, fragte sie, ob sie lieber Miss Ostdeutschland oder Miss Gesamtdeutschland werden würde.
„Offiziell natürlich Miss Gesamtdeutschland!“, sagte sie.
„Und inoffiziell?“, fragte der Reporter.
Inoffiziell sei sie stolz, es den Anderen auch endlich mal zeigen zu können und sich durchzusetzen.
Wer denn diese Anderen überhaupt seien, bohrte der Reporter weiter.
Читать дальше