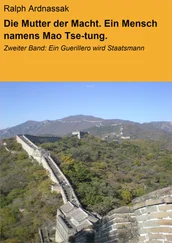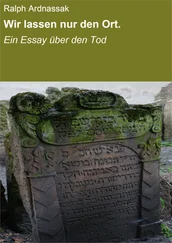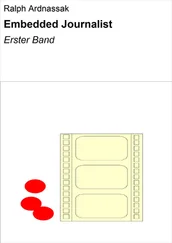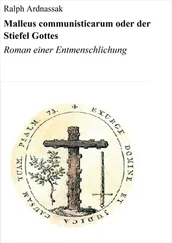Denn der Tod war etwas, dem niemand entging und im Sterben und im Tode wurden alle Menschen wieder gleich und die Gegensätze zwischen ihnen schwanden angesichts des Todes dahin, das hatte ich schließlich oft genug hier in der Klinik erlebt.
Der Tod war der einzig wahre und wirkliche Gleichmacher, der über die Menschen damit kam, wie die große Französische Revolution, die mit ihrem Terror auch alle gleich gemacht hatte.
Der Tod war der große Gleichmacher. Er war derjenige, der aus den verfeindeten und sich bekämpfenden und beneidenden Menschen am Ende doch endlich wieder Brüder machte, indem er sie alle dasselbe erleiden ließ und sie in sich wieder vereinte.
Vor diesem Hintergrund war es vollkommen sinnlos, dem Tode durch Gier entrinnen zu wollen.
Frech und unverschämt!
Von Redakteur Franz Xaver Paulsen aus Athen
Die griechischen Milliardäre und Millionäre, vor allem jedoch die berüchtigten Reeder-Clans, deren hartnäckige Weigerung, im Inland Steuern zu zahlen, für die wirtschaftliche Krise des Landes verantwortlich gemacht wird, werden auch künftig definitiv ungeschoren davon kommen, im Lande selbst alle Vorteile finanzieller Natur wahrnehmen, wo immer es geht, ihre märchenhaften Gewinne jedoch vor dem griechischen Fiskus in Steueroasen des Auslands in Sicherheit bringen.
Patriotisches und verantwortungsbewusstes Handeln im Sinne der Gemeinschaft, sieht anders aus. Allerdings ist dies ein Modell, welches Reiche inzwischen überall auf der Welt, auch in Deutschland, straflos und praktisch unter den Augen der Finanzbehörden ganz offen praktizieren. Diese Leute lassen sich gern Eliten nennen, erweisen sich jetzt jedoch als gieriges und korruptes Pack, dem das Gemeinwohl Schnurz ist, solange nur die persönliche Bilanz im Positiven bleibt. Konstruktive Beiträge zur Lösung drängender nationaler Probleme wird man von den sogenannten Eliten wohl weder in Griechenland, noch sonst irgendwo auf dieser Welt erwarten können!
Dem griechischen Volk wird dafür hingegen die Rechnung in Gestalt der drakonischen Sparpolitik durch die EU präsentiert. Abstriche bei der Lebensqualität der kleinen Leute gibt es fast überall, während die Reichen in Saus und Braus leben und mit keinem einzigen Cent ihrer privaten Vermögen für die Genesung ihres Landes aufkommen müssen.
Was Wunder, dass der griechische Wähler den Mächtigen nun seinerseits die Quittung präsentierte, indem das Spardiktat abgewählt und das Linksbündnis SYRIZA mit beinahe absoluter Mehrheit auf den Schild gehoben wurde.
EU-Kommissar Günter Oettinger (CDU) nannte die neue Politik Griechenlands indes „frech und unverschämt“; Griechenland dürfe nun, als Reaktion der Europäischen Union auf seine Anmaßung, keinerlei Verbesserungen seiner prekären wirtschaftlichen Lage mehr erwarten, so Oettinger.
Ein Krankenhaus ist ein Tempel des Leids und des Schmerzes, aber auch der Hoffnung. Es ist ein Ort, an dem man mit dem Tod und dem Sterben auf Du und Du ist.
Wie viel Verzweiflung, wie viel Angst mag sich unter dem Giebel eines einzigen Krankenhauses versammelt haben? Wie viel ängstliches Hoffen und heimliches Versagen mag von dort aus in den Himmel aufgestiegen sein?
Niemand hielt sich gern als Patient in einer Klinik auf und selbst als Besucher beschlich einen ein eigenartiges Gefühl der Scheu und der Vorsicht, so dass man geneigt war, während der Dauer seines Aufenthaltes in einer Klinik beinahe den Atem anzuhalten.
Man empfand Beklemmung dabei, laut zu sein oder zu essen oder gar zu lachen, an einem Ort, an dem Schmerz allgegenwärtig war und in dem der Tod tagtäglich ein und aus ging, als sei ein Krankenhaus nichts weiter als eine Art Wirtshaus für den Sensenmann.
Man empfindet Ehrfurcht vor dem Leben und seiner Fragilität; Ehrfurcht vor dem Siechtum und dem Sterben der Menschen.
Ein Schmerzenshaus, ein weißes Haus der Angst, ein stilles Haus des Todes. Ein Leidenshaus, ein Schreckenstempel.
Wer hierher mit der Diagnose Lungenkrebs kommt, der weiß, dass fünf Jahre nach der Feststellung des Leidens weniger als 10 % aller Betroffenen noch am Leben sein werden.
Er weiß auch, wenn er, vielleicht nach Wochen oder gar Monaten der anhaltenden Heiserkeit und des Bluthustens, mit jeder Faser auf eine Chance hoffend, die Schwelle der Klinik überschreitet, dass es für eine erfolgreiche Therapie schon längst zu spät ist und dass jeder therapeutische Schritt nicht mehr kurativ ist, wie die Ärzte sagen, sondern lediglich zur Verbesserung der Lebensqualität in den letzten Tagen und Wochen beitragen wird.
Wer hierher mit der Diagnose Lungenkrebs kommt, kommt auch, um Abschied zu nehmen. Abschied vom Leben und von seinen Lieben, denn mit der Behandlung auf der onkologischen Station beginnt meist auch, für alle Menschen deutlich sichtbar, der Prozess des langsamen, wenngleich immer weiter hinausgezögerten Sterbens des Patienten.
Der Kranke wird meist wehleidig oder apathisch, andere entwickeln eine in sich gekehrte Verhaltensweise, in der sie eigenartig naiv wirken, wie Kinder oder Geisteskranke. Andere werden laut und impulsiv, flüchten sich in allerlei Aktivitäten, als könnten sie dem Tod, er ihnen doch stets auf den Fersen bleibt, auf diese Weise davon laufen.
Ich habe beizeiten und gleich zu Beginn meines Berufslebens gelernt, dass Sterben stets etwas Individuelles ist, wie die Geburt und das ganze Leben. Keine zwei Sterbevorgänge aufgrund derselben Diagnose, sogar dann, wenn die Patienten im selben Alter sind, gleichen einander. Jedes Sterben ist individuell, ist einzigartig und unwiederbringlich. Es is wie eine große Sinfonie, die nur ein einziges Mal auf einer Konzertbühne aufgeführt werden kann und danach nie wieder, weil die Musiker die Noten vergessen und weil die Instrumente ihren Dienst versagen.
Kein Tot kann je kopiert oder ein zweites Mal gestorben werden. Wie das Individuum seinem Leben, seiner Art, mit Schicksalsschlägen umzugehen, seinen einzigartigen Stempel aufgedrückt hat, so macht es auch beim Sterben ein allerletztes Mal von diesem Stempel Gebrauch, ehe er endlich in den Wirren der Zeit verschwindet und vergessen wird, dieser einzigartige Stempel, der Geschehnissen im Zusammenhang mit einer bestimmten Person ihre Singularität verleiht.
Mein Schwiegervater war still und höflich, als er in die Klinik kam und sein Bett auf der onkologischen Station zugewiesen bekam.
Ich war auf einer anderen Station beschäftigt, aber ich besuchte ihn, sooft ich konnte. Ich besuchte ihn täglich.
Er war still und höflich und selbst, wenn er nichts sagte, so fragten seine Augen doch bang bei jedem Eintreten in sein Dreibettzimmer: Wie lange habe ich noch zu leben?
Ich flüchtete mich in all die Hilfskonstruktionen, wie es jeder Mensch tut, der einen Angehörigen mit dieser Diagnose in einer Klinik besucht.
Brachte Obst mit oder Süßigkeiten oder Zeitschriften, in denen die Fußball-WM thematisiert wurde; forderte ihn auf, das Bett zu verlassen, um mit mir nach unten zu gehen, in die Cafeteria, wo es Wiener Würstchen gab, die er gern mochte. Nötigte ihn, mit mir auf den Balkon des Zimmers zu kommen, von wo man über das Grün einer akkurat gemähten Wiese blicken konnte oder direkt in die kräftige Krone einer einsamen alten Kiefer hinein, die vor der Fassade der Klinik stand.
Ich vermied die Themen Tod und Sterben, bagatellisierte die Untersuchungen, selbst Bronchoskopie und Biopsie, als würden sie dadurch weniger beängstigend und schmerzhaft und bemühte mich, mit ihm zu scherzen.
Er aber, der selbstsichere Mann, der ein Leben lang fröhlich und optimistisch gewesen war, wurde still und in sich gekehrt und als ich eines Nachmittags mit der Psychologin über ihn sprach, riet sie zur Einnahme von Stimmungsaufhellern.
Читать дальше